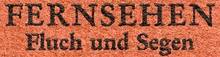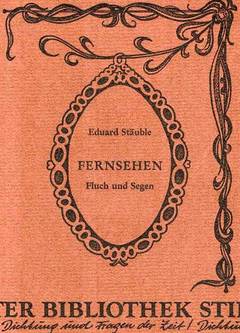1979 - "Fluch und Segen - FERNSEHEN - Macht und Ohnmacht"
Überreicht vom Fernsehen der deutschen und der räto- romanischen Schweiz - Herausgegeben von EUGEN THURNHER - Die »Stifterbibliothek« begründet von Prof. Dr. Ferdinand Wagner - 1979 erschienen by Stifter- bibliothek im Verlag Anton Pustet Salzburg.
.
INHALT
.
- Vorwort des Autors .............................. 7
- Fernsehen und Kultur........................... 11
- Fernsehen und Bildung......................... 33
- Fernsehen und Manipulation.................. 65
.
von Dr. Eduard Stäuble (Jahrgang 1924) († März 2009) - Er leitet(e) seit 1965 die Programm- abteilung »Kultur und Wissenschaft« beim Fernsehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz in Zürich.
.
Das Büchlein aufgehoben und wiedergefunden im Januar 2025
In allen Fernsehsendern der Welt wurde es fast Tag und Nacht gezeigt, in allen anderen Medien wurde es ebenfalls als bombastische alternativlose Nachricht verbreitet - und immer ganz oben als die "Top-Nachricht" : Der 78 Jahre alte Polit-Rambo Donald Trump wurde im Januar 2025 der gewählte 47. President der Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese erneute Wahl des neuen und dennoch alten Möchtegern-Diktators war ganz sicher frei und geheim und dennoch gab es viele Denkansätze, daß in dem großen in dieser Welt wichtigsten Land der unbegrenzten Möglichkeiten etwas schief gelaufen sein könnte. Und das beschreibt der Autor Dr. Eduard Stäuble (Jahrgang 1924) bereits im Jahr 1979. Was war da schief gelaufen und konnte man das voraussehen ? Ganz am Ende des Büchleins wird es nochmal formuliert.
.
VORWORT (aus dem Jahr 1979)
Die in dieser Schrift zusammengetragenen Gedanken über einige Aspekte des Fernsehens könnten ihren gemeinsamen Grund alle in jenen berühmten Worten haben, die am Schluß der Vorrede zu Adalbert Stifters »Bunten Steinen« stehen:
»Wie es mit dem Aufwärtssteigen des menschlichen Geschlechtes ist, so ist es auch mit seinem Abwärtssteigen. Untergehenden Völkern schwindet zuerst das Maß. Sie gehen nach einzelnem aus, sie werfen sich mit kurzem Blicke auf das Beschränkte und Unbedeutende, sie setzen das Bedingte über das Allgemeine; ... in ihrer Kunst wird das Einseitige geschildert, das nur von einem Standpunkte Gültige, dann das Zerfahrene, Un-stimmende, Abenteuerliche . . . der Unterschied zwischen Gut und Böse verliert sich, der einzelne verachtet das Ganze und geht seiner Lust und seinem Verderben nach, und so wird das Volk eine Beute seiner inneren Zerwirrung oder die eines äußeren, wilderen, aber kräftigeren Feindes . . .«
Mit einer Stifterschen Haltung des Maßes soll hier einem Gegenwartsphänomen wie dem Fernsehen gegenübergetreten werden, nicht mit einem kurzen Blick auf das Beschränkte und Unbedeutende und nicht das Bedingte über das Allgemeine setzend.
Es soll nichts hochgejubelt und beschönigt, aber auch nichts verflucht und verfemt werden. Es werden keine übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen geweckt, aber ebenso werden wir uns vor einer Verteufelung hüten. Aus maßvoll kritischer Distanz heraus, mit dem Blick aufs Ganze und Allgemeine soll einigen Fragen nachgegangen werden, die ein Medium an uns richtet, das heute zwar seit rund einem Vierteljahrhundert bei uns im Gebrauch steht, über dessen Wert und Unwert, Fluch und Segen, Macht und Ohnmacht aber immer noch die widersprüchlichsten Meinungen miteinander im Streite liegen.
Dieser Streit soll und kann hier nicht geschlichtet werden. Der Autor will im Gegenteil eine sehr persönliche und entschiedene eigene Haltung einnehmen - im vollen Bewußtsein, daß er Zustimmung hier, Ablehnung dort erfahren wird. Dies bekümmert ihn nicht; er ist zufrieden, wenn es ihm gelingt, vielerseits zum Nachdenken anzuregen und zur Auseinandersetzung herauszufordern.
In vierzehn Jahren Fernseharbeit sammelt sich einiges an Erfahrungen an, und wenn Erfahrungen auch nie alleingültige Wahrheiten darstellen, so können sie doch da und dort ein sinnvolles Gespräch über Gebrauch und Mißbrauch, Möglichkeiten und Grenzen eines Mediums befruchten, das gerade seiner hohen Bannkraft wegen die vielfältigsten Auswirkungen auf uns und unsern Lebensalltag hat.
.
Die Frage nach dem "Warum"
Nach einem eher kritischen Vortrag über das Fernsehen fragte mich einmal ein Zuhörer, warum ich denn trotz lebhafter Bedenken bei diesem Medium arbeite. Die Frage war berechtigt, und ich hatte sie mir selber öfter schon gestellt.
Dabei war ich zu einer durchaus klaren Antwort gelangt: Weil ich glaube, daß das Fernsehen trotz seiner schwierigen Eigenart ein mächtiges Instrument ist zur Erhaltung einer freien und menschlichen Gesellschaft, ein vorzügliches Mittel zur Horizonterweiterung, ein Forum der Ideen, ein Anreger und Impulsgeber, eine Waffe gegen Vorurteile und Ungerechtigkeit.
Damit es dieses alles ist und bleibt, muß man sich aber tatkräftig dafür einsetzen. Und je mehr Leute dieses beim und mit dem Fernsehen selber tun, um so besser; auch dies wiederum im Sinne eines Stifter-Wortes, das der Dichter 1848 in seinem Aufsatz »Über Stand und Würde des Schriftstellers« geschrieben hat:
»Es ist hier wieder wahr, was beinahe als Gesetz der Natur gelten könnte, daß, je himmlischer eine Himmelsgabe ist, desto furchtbarer ihr Mißbrauch sich rächt.«
.
Das Fernsehen eine himmlische Himmelsgabe ?
Ob man das Fernsehen nun als eine besonders himmlische Himmelsgabe betrachtet oder nicht, sicher ist, daß sich sein Mißbrauch auf die Dauer sehr gefährlich rächen kann.
Die technische Entwicklung dieses Mediums ist noch längst nicht an ihrem Ende angelangt; sie wird uns noch viele neue Möglichkeiten, Probleme und Sorgen bescheren. Desto notwendiger ist es, daß wir unsere Einstellung diesem Medium gegenüber immer wieder von neuem prüfen und klären, damit wir ihm gegenüber frei bleiben und es uns nie in seinen Griff bekommt.
Aufklärung über das Medium tut auch heute noch und bei jeder heranwachsenden Generation von neuem not. Ein kleines Stück solcher Aufklärung will in den folgenden drei Kapiteln geleistet werden, wobei die Gedanken fortschreiten vom Allgemeinen, der umgreifenden Frage nach dem Verhältnis des Fernsehens zur Kultur, über den Teilaspekt des Mediums als Bildungsfaktor zum speziellen Problem der fernsehimmanenten Manipulation.
Einige Stellen mögen deutlich aus der Sicht eines Schweizer Fernsehmachers geschrieben sein. Was man davon nicht als verbindliche Argumente zu akzeptieren gewillt ist, möge man wenigstens als Information über die besonderen Fernsehverhältnisse in diesem Lande annehmen.
Und wenn einige Beispiele in Bälde veraltet und einige Zahlen in Kürze überholt sein werden, so läßt sich dies in unserer schnellebigen Zeit nicht nur nicht verhindern, es fällt in unserem Zusammenhang auch nicht allzusehr ins Gewicht; denn der Verfasser meint, sich um einige Einsichten bemüht zu haben, die von hinreichend grundsätzlichem und dauerhaftem Ernst sind und nicht so bald aus den Diskussionen um den rechten Umgang mit dem Medium Fernsehen verschwinden werden.
Im August 1979 Eduard Stäuble
.
FERNSEHEN UND KULTUR
.
Das »Fernsehen«
»Fernsehen« kann vieles bedeuten. Es ist zunächst ein Apparat, der in ungezählten Wohnstuben steht und den man nach Belieben an- oder abschalten kann. »Fernsehen« ist aber auch das Programm, das in diesem Apparat läuft: Live-Übertragungen, Studio-Sendungen, Filme, alte und neue, Informatives und Unterhaltendes, für Kinder und Erwachsene. Das »Fernsehen« sind aber auch die Leute, die diese Programme machen und zusammenstellen. Fernsehen spielt sich mittels eines technischen Mediums zwischen Programmachern und Zuschauern ab. Die einen lassen sich von den andern nicht trennen.
Kultur gegen Zivilisation?
.
Und was heißt »Kultur«? Hanns Johst hat seinerzeit gesagt, er zücke den Revolver, wenn er das Wort nur höre. Das führt natürlich nirgends hin. Aber es führt auch nicht viel weiter, wenn man philosophische Wörterbücher zückt. Es gibt zahllose wissenschaftliche Definitionen dieses Begriffs (nach dem neuesten Stand der Zählung sind es etwa 180), und keine vermag alle ganz zu befriedigen.
Nun kommt in der Schweiz mit ihren verschiedenen Sprachregionen erschwerend hinzu, daß für den Westschweizer »culture« nicht dasselbe bedeutet wie »Kultur« für den Deutschsprachigen. Unsere »Kulturgeschichte« ist auf französisch die »Histoire de la civilisation«. Im Deutschen hat das Wort »Zivilisation« einen eher minderwertigen Beiklang.
Diese Begriffsspalterei grenzt ein bißchen an Schizophrenie. Kultur wäre demnach das Höhere, das Elitäre, die Bel-Etage der Kunst, der Literatur, der Musik, der Wissenschaft, der Philosophie.
Zivilisation dagegen wäre der Bereich der technischen Errungenschaften und des Komforts, eine, wenn es hoch kommt, »Kultur im Erdgeschoß«, jenes Minimum an Kultur sozusagen, durch das sich der Mensch gerade noch vom Affen unterscheidet.
Wir sollten, meine ich, diese unselige Scheidung vermeiden. Da lobe ich mir den englischen Völkerkundler Edward Tylor, der schon 1871 seine Kulturdefinition begonnen hat mit den Worten: »Kultur oder Zivilisation ist jenes komplexe Ganze, das . . .«
Er setzt Kultur und Zivilisation gleich und nennt beides ein »komplexes Ganzes«. Das ist mir überaus sympathisch.
.
Aus meiner Praxis beim Fernsehen
Ich leite beim Deutschschweizer Fernsehen die »Abteilung Kultur und Wissenschaft«. Diese Bezeichnung ist nicht mehr als ein notdürftiger, ja falscher Hilfsbegriff, weil sie den Anschein erweckt, Kultur und Wissenschaft seien zwei verschiedene, getrennte Bereiche auf gleicher Ebene. Das sind sie, meines Erachtens, nicht. Vielmehr würde ich Kultur (und Zivilisation) als einen umfassenden Oberbegriff verstehen und die Wissenschaft als eines der vielen kulturellen Teilgebiete.
Kultur = Arbeit
.
Kultur ist eben nicht einfach gleichzusetzen mit Literatur, Musik, Malerei, Theater, Film und Philosophie. Und darum kann hier auch nicht nur die Rede sein von Kunst- und Literatur-, von Musik- und Theatersendungen im Fernsehen.
Sonst müßte das Thema lauten: »Das Fernsehen und die Kunst.« Es heißt aber: »Fernsehen und Kultur.« Und zur Kultur (und Zivilisation) eines Volkes, einer Gesellschaft, einer Epoche gehört viel mehr: zum Beispiel auch die Mode, der Tanz, das Spiel, das Essen und Trinken, das gesellschaftliche Leben und das staatliche Zusammenleben, das Schul- und Bildungswesen, die Wirtschaft, der Verkehr, die Technik, die Medizin, Religion, Sitte, Moral, der Staat, die Politik und so weiter. Meinetwegen auch die Gemüsekultur.
.
- Anmerkung : Hier hat der Herr Dr.Stäuble bei der Aufzählung der Merkmale einer Kultur eines Landes ein Thema vergessen : die "Sprache".
.
Mit der Gemüsekultur fängt die Kultur sogar an, etymologisch nämlich:
Kultur hat etwas zu tun mit dem lateinischen »cultura«. Das leitet sich her von »colere«: hegen und pflegen, anbauen, bebauen. Agricultura steht am Anfang der cultura: Bearbeitung und Pflege des Bodens, des Ackers, des Feldes, des Gartens; Urbarmachung und Verbesserung des Bodens, um ihn menschlichen Bedürfnissen und Wünschen anzupassen und dienstbar zu machen.
Und dann die Körperkultur: Pflege, Verbesserung, Veredelung des Körpers und seiner Fähigkeiten (auch Sport gehört zur Kultur - und darum ist seine staatliche Betreuung durch Militärdepartemente eigentlich fehl am Platz .....). Schließlich die Kultur des Geistes und der Seele, die cultura animi, wie Cicero sie nannte.
Kultur meint demnach nicht die Gesamtheit der erwähnten Lebensbereiche des Menschen, sondern die Tätigkeit, die Aktivität und Kreativität des Menschen auf all diesen Gebieten: das Hegen und Pflegen, das Verbessern, Veredeln und Bilden.
.
Das "Vocabularius sancti Galli" - also doch : die Sprache
In der Stiftsbibliothek St. Gallen wird ein Wörterbüchlein aufbewahrt, der sogenannte "Vocabularius sancti Galli", das lange Zeit dem irischen Mönch Gallus zugeschrieben wurde, der es angelegt haben soll, um die Sprache der Alemannen zu lernen.
Wenn man auch heute weiß, daß es nicht von Gallus selber stammt, so ist es dennoch ein aufschlußreiches Sprachdokument aus dem 8. Jahrhundert. In diesem Vocabulaire sind die Wörter auf lateinisch und altdeutsch aufgezeichnet. Und da lesen wir zum Beispiel auch den Begriff »cultura«, der vom unbekannten Verfasser übersetzt wird mit »arwis« - das ist eine altdeutsche Form für »Arbeit«. Ich finde das großartig: Kultur = Arbeit. Nicht einfach passiver Genuß, sondern Arbeit. Ich meine, man müßte jede Kulturdefinition danach beurteilen, ob sie aktiv formuliert sei.
Eine Probe aufs Exempel an einem x-beliebigen Beispiel. Friedrich Jodl, er lebte von 1849 bis 1914, war Philosophieprofessor in Prag und Wien, schreibt in seinem Buch »Der Monismus und die Kulturprobleme der Gegenwart« (erschienen 1911): »Wir müssen die Menschen zur Ehrfurcht erziehen vor diesem gewaltigen Phänomen (Kultur), welches uns das Geschlecht durch eigene Kraft emporsteigend zeigt von der tierischen Horde zur beseelten Gesellschaft, und von den primitivsten Denkäußerungen zu jenem ungeheuren Besitz an Gedanken und technischem Können, über den wir heute verfügen - ein Schatzhaus der Jahrtausende, eine Welt über der Welt und doch kein Jenseits, sondern aus der Welt gewonnen, auf sie bezogen.« Durch eigene Kraft emporsteigend -Jodl hat offenbar eine stark aktive Vorstellung von Kultur.
.
Die Verantwortung der Programmgestalter
.
Aber bis jetzt war immer nur von der Kultur die Rede - wo bleibt das Fernsehen? Ich meine es so: Wer Mittel (Medien) in der Hand hat wie die Schule, das Radio, den Film, die Presse, den Buchdruck, das Fernsehen, der hat kulturelle Aufgaben, eine kulturelle Verpflichtung und Verantwortung. Das heißt, er ist aufgerufen, mitzuhelfen bei der Pflege, der Verbesserung und Veredelung der geistigen und materiellen Lebensverhältnisse des Menschen.
Alle diese Mittel werden nur dann richtig und verantwortungsbewußt gehandhabt, wenn sie beitragen zur immer erneuten Entwicklung des Menschengeschlechts »von der tierischen Horde zur beseelten Gesellschaft« (denn diese Gesellschaft ist ständig bedroht von einem Rückfall in die tierische Horde), wenn sie täglich von neuem beitragen zur Entwicklung »von primitivsten Denkäußerungen zu jenem ungeheuren Besitz an Gedanken und technischem Können, über den wir heute verfügen« (und der uns stets verlorenzugehen und vom sinnvollen Gebrauch in sinnlosen Mißbrauch umzuschlagen droht. Man kann diese Mittel bekanntlich auch in entgegengesetztem Sinne gebrauchen, so daß sie der Verdummung und Verblödung, der Verhetzung, Verschlechterung, ja Zerstörung des Menschengeschlechts förderlich sind; Beispiele gibts genug dafür).
.
Fernsehen - kulturelle Aufgabe und Verantwortung
Im Blick auf das Fernsehen heißt dies: Eine kulturelle Aufgabe und Verantwortung hat jeder, der beim Fernsehen mit der Gestaltung des Gesamtprogramms und einzelner Sendungen beschäftigt ist. Derjenige, der sich mit einer sachlichen, gut dokumentierten Information über weit- und innenpolitische Ereignisse befaßt, trägt ebensoviel kulturelle Verantwortung wie jener andere, dem die Auswahl und Inszenierung eines Fernsehspiels obliegt.
In der Gestaltung der Kinder- und Jugendstunden liegt nicht weniger kulturelle Verantwortung als in der Gestaltung einer Sendereihe über Einsteins Relativitätstheorie oder über die Renaissance. Nicht zu vergessen das weite Gebiet der Unterhaltung: Spaß und Spiel gehören mit zum Leben und zur Kultur; aber auch auf dem Gebiet der leichten Muse ist es möglich, geschmackvollen, geistreichen, artistisch wertvollen Sendungen den Vorrang zu geben gegenüber kunstlosen und stumpfsinnigen Sendungen.
Kultur findet im Fernsehen nicht nur zu bestimmten Stunden, in bestimmten sogenannten »Sendegefäßen« statt - etwa wenn die »Minna von Barnhelm« gesendet wird oder ein Dokumentarbericht über Erasmus von Rotterdam oder die Übertragung des Neu-Jahrskonzertes der Wiener Philharmoniker oder ein Film über die Malerei des Surrealismus oder ein Englischkurs. Kultur findet im Fernsehen immer statt — sollte immer stattfinden, in jeder Sendung und zu jeder Stunde.
Kulturelles Verantwortungsbewußtsein zeigt sich in der gesamten Programmgestaltung ebenso wie in der Art und Weise, wie zum Beispiel Nachrichten ausgewählt, sprachlich formuliert und wertend kommentiert werden; es zeigt sich in der Art und Weise, wie über die Abtreibung diskutiert wird, ebenso wie in der Form, in der die Werbesendungen gestaltet sind.
.
Beispiele (mit Blick auf Deutschland)
Ein Redaktor der Tagesschau zum Beispiel bewiese wenig kulturelles Verantwortungsbewußtsein, wenn er einem Filmbericht über die Wahl der Miß Universum drei Minuten Zeit einräumen würde, dem Bericht über die Nobelpreis-Verleihung an den wissenschaftlichen Bezwinger der Kinderlähmung hingegen nur dreißig Sekunden; er bewiese wenig kulturelle Haltung, wenn er über den Tod irgendeines ExBoxweltmeisters zwei Minuten lang berichten ließe, den Tod von Martin Buber aber überhaupt nicht erwähnte. - Mit Max Frisch zu sprechen: »Es soll sich kein Volk einbilden, es habe Kultur, nur weil es Sinfonien hat.«
Wenn die Schweiz, wie gelegentlich beklagt wird, ein kultureller Holzboden ist, so kommt diese Beurteilung vielleicht daher, daß man Kultur mit Kunst verwechselt, also eine rein ästhetische Kultur meint.
.
Kultur-Gestaltung
Wenn man aber in die Kultur die Gestaltung des politischen Lebens mit einbezieht, so kann man - wie Max Frisch sagt - unter Kultur auch, ja »in erster Linie die staatsbürgerlichen Leistungen« verstehen, und die zählen bekanntlich hierzulande - wie wiederum Frisch meint - höher »als das künstlerische oder wissenschaftliche Meisterwerk eines einzelnen Staatsbürgers«.
Aus diesem Grunde weigere ich mich auch, auf sogenannte »Kultursendungen im Fernsehen« hinzuweisen und mich zu brüsten: Seht her, wieviel wir für die Kultur tun! (10 Prozent Einschaltungen bei einem Sinfoniekonzert sind 300.000 Zuhörer, und das sind, bei zehn solchen Sendungen, viel mehr, als in allen Konzertsälen der Schweiz während eines ganzen Jahres Platz hätten.) Das ist doch ganz selbstverständlich und notwendig, daß man solche Sendungen bringt. Das braucht doch nicht eigens betont und verteidigt zu werden.
.
Der mitternächtliche Rand der Programme
Das Bedenkliche daran ist vielmehr, daß solche anspruchsvolleren Sendungen oft an den mitternächtlichen Rand der Programme verdrängt werden. Dort fristen sie dann unter Ausschluß der Öffentlichkeit das eher klägliche Dasein bloßer Alibi-Sendungen. Man braucht sie — die Kultur-, Wissenschafts- und Theatermagazine, die Künstlerporträts und kulturellen Dokumentarfilme -, damit man ein etwas weniger schlechtes Gewissen zu haben braucht, wenn man das Medium im übrigen mehr nur als nervenkitzelndes oder sanft und seicht einlullendes Unterhaltungsinstrument mißbraucht.
Dabei zeugte nur dies von einem richtigen Kulturverständnis und einer echten kulturellen Haltung: wenn man den Mut aufbrächte, auch zu den besten Sendezeiten anspruchsvolle Sendungen zu zeigen und die Interessen anspruchsvollerer Minderheiten sogar überproportional zu berücksichtigen.
Das Fernsehen überschüttet sein Publikum täglich und stündlich mit einer Fülle von wechselnden Bildeindrücken. Dadurch wird es für alle diejenigen, die es nicht mit Vorsicht genießen, zu einer großen Gefahr.
Es kann, bei undosiertem und wahllosem Gebrauch, eine bedenkliche und bedrohliche Zerrüttung des menschlichen Geistesund Seelenlebens, eine totale Zerfahrenheit und Abstumpfung zur Folge haben.
.
Die Verführung des Fernsehens
Das Fernsehen müßte seinen eigenen Gefahren entgegenwirken, indem es nicht nur pausenlos oberflächliche Tagesinformation und Unterhaltung liefert, sondern den Zuschauer auch zur Bewertung, Verarbeitung und Bewältigung des immensen Informationsangebots befähigen würde — und das heißt: immer wieder, und zwar auch zu den publikumsstärksten Sendezeiten, Sendungen brächte, die einer vertiefteren Darlegung und einem gründlicheren Verständnis von Themen und Problemen auf allen Gebieten des Lebens dienen, Sendungen auch, die den Zuschauer immer wieder mit neuen, ungewohnten Möglichkeiten aus allen Lebensbereichen des Menschen konfrontieren, damit er nicht in den altgewohnten Vorstellungen verharrt und verfault.
Das Fernsehen muß gegen seine eigene Verführung kämpfen, die das Instrument zu einem bloßen Varieteersatz für zerstreuungssüchtige Massen erniedrigen möchte.
Die Verantwortung der Zuschauer
.
Der Fernsehapparat - das volksverdummende Glotzophon
Nebst verantwortungsbewußten und risikofreudigen Programmachern ist dazu aber auch ein anforderndes und risikobereites Publikum vonnöten. Kultur ist nicht etwas, das vorhanden wäre und dessen man sich bedient oder nicht.
Kultur entsteht und existiert nur in Zusammenhängen und Zusammenspielen. Dabei spielt das Publikum eine wichtige Rolle. Von ihm hängt es entscheidend mit ab, ob das Fernsehen etwas mit Kultur zu tun hat oder nicht. Wenn es vom Fernsehen verlangt und erwartet, daß es vor allem oder gar ausschließlich einem primitiven Massengeschmack huldige, ihn verbreite oder sogar rechtfertige, wird aus dem Fernsehen leicht ein kulturfeindliches Instrument.
Wenn es vor allem das Federgewichtige, das Sanft ausgewogene und Leichteingängliche, das Kanten- und Spitzenlose, das Brave, Biedere und Unkritische verlangt - und wenn die Programmacher solchem Verlangen glauben bedingungslos nachgeben zu müssen, weil sie auf den Kult der hohen Zuschauerzahlen eingeschworen sind -, muß sich niemand wundern, wenn der Fernsehapparat zum volksverdummenden Glotzophon wird.
.
Die Sucht nach der "Quote"
Ich weiß gar nicht, warum eigentlich immer möglichst viele Leute vor dem Apparat sitzen müssen. Die Leute sollen doch auch wieder einmal etwas anderes tun, als immer nur fernsehen. Von Fernsehleuten, für die hohe Zuschauerzahlen wie eine Offenbarung sind, sagt Harry Pross, das seien »Produzenten, die auf die ihnen vorgesetzten Zahlen reagieren wie die Affen auf den Futternapf: immer sich nach der letzten höchsten Einschaltzahl richten und niemals ihr Futter an einer anderen Stelle suchen als dort, wo sie zuletzt die hohen Zahlen fanden. Wir hätten dann - sagt Pross - Dressur, wo wir uns einbildeten, Kultur zu haben«.
Wenn das Fernsehen einem möglichst breiten Publikum immer nur gibt, was es wünscht, vergessen die Zuschauer völlig, was sie eigentlich noch anderes wünschen könnten als das, was ihnen ohnehin bereits in Hülle und Fülle geboten wird.
Dann tritt ein Nivellierungseffekt ein, der auf die Dauer eine erschreckende substantielle Aushöhlung der Programme und damit auch der Zuschauer zur Folge haben muß. Das Fernsehen hat die Pflicht, dieser gefährlichen Niveausenkung, der Passivierung, der Gewöhnung der Zuschauer an das Immergleiche entgegenzuwirken. Es muß auch aufstörend und anstößig wirken.
.
Der letzte Rest des eigenen Willens
Gerade für eine Demokratie wie die unsere ist es lebenswichtig, daß das Volk geistig aufgeschlossen, flexibel und denkfähig bleibt. Ich könnte mir kaum etwas Entsetzlicheres vorstellen als ein ganzes Volk, das Abend für Abend nur noch biertrinkend und nüßchenknabbernd vor der Mattscheibe hockt und sich unkritisch und anspruchslos seine reichlich primitiven Programmwünsche erfüllen ließe - in der irrigen Meinung, es geschehe alles nach seinem Willen, obwohl ihm der letzte Rest an eigenem Willen, an Eigenwilligkeit, schon längst ausgetrieben worden ist. Dann wäre das Fernsehen wirklich nur noch ein Instrument der Massenhypnose, ein neues »Opium des Volkes«.
Anderseits wäre es zweifellos ein Verhältnisblödsinn, wenn man mit dem Medium Fernsehen ein Programm für zwei, drei Zuschauer machen wollte. Es ist nun einmal ein Medium, mit dem man gleichzeitig sehr viele Leute erreichen kann.
Schon eine Einschaltquote von nur ein Prozent bedeutet bei uns (in der Schweiz) bereits 30.000 Zuschauer. Gerade dies verpflichtet aber auch wieder die Macher, auch anspruchsvolle Sendungen über wichtige Themen im Fernsehen so darzubieten, daß sie ein großes Publikum zu interessieren vermögen und von möglichst vielen Zuschauern verstanden werden können.
Die Macher müssen sich bemühen, ihre Sendungen möglichst allgemeinverständlich, anschaulich, leicht faßlich, lebendig und spannend zu gestalten; dann werden auch anspruchsvolle Sendungen ganz von selbst unterhaltsam.
Eine hochnäsig elitäre Einstellung ist einem Fernsehmacher absolut verboten. Leute solchen Schlags mißverstehen einen zeitgemäßen Kulturbegriff ebenso wie das Medium Fernsehen. Man soll im Fernsehen nicht so produzieren wollen, wie es beispielsweise Sache einer gehobenen, exklusiven Literatur- oder Kunstzeitschrift ist.
Fernsehen ist kein Medium für gebildete Nabelschau kulturbeflissener Redaktoren. Es ist, ob das einem passe oder nicht, ein hochmultiplikatives Medium. Wer es mit einem elitären Kulturbegriff angeht, landet bald bei einem kulturfeindlichen Fernsehbegriff.
.
Fernsehen und Freizeit
.
Das Fernsehen - ein Zeitvernichter ?
Es ist leicht, dem Fernsehen Kulturfeindlichkeit vorzuwerfen. Wenn das Fernsehen von Zuschauern und Machern falsch gehandhabt wird, wird es tatsächlich zu einem Zeitvernichter. Es braucht Zeit, ein Buch zu lesen, ins Theater oder ins Kino zu gehen, sich mit Freunden zum Gespräch zu treffen, seinem Hobby zu frönen, eine Ausstellung zu besuchen, an einer politischen Veranstaltung teilzunehmen, Fußball zu spielen oder einen Waldlauf zu machen.
Je mehr Zeit bei unkontrolliertem Fernsehen draufgeht, um so weniger bleibt für persönliche kulturelle Tätigkeit. Es verlockt zur Passivität und führt zum Kommunikationsverlust.
Hier zeigt sich, wie eng das Thema »Fernsehen und Kultur« mit dem Thema »Fernsehen und Freizeit« zusammenhängt.
Das Fernsehen wird kaum je eine Rolle spielen während unserer Arbeitszeit (ausgenommen beim Fernsehmacher selbst); es tritt vielmehr als typisches Freizeitmedium in Erscheinung.
Und in Anbetracht dessen, daß uns die Soziologen glaubhaft nachweisen, daß sich die Freizeit in Zukunft noch beträchtlich vermehren wird, stellt sich die Frage, welche Funktion dem Fernsehen in dieser zunehmenden Freizeit zukommen wird. Ist es schon ein Zeitvernichter, so ist es vor allem ein Freizeitvernichter.
Der Mensch, der aus seinem Arbeitstag hinaustritt in den Raum der Freizeit und dort nichts anderes sucht als Zerstreuung, Ablenkung, Vergessen, bestenfalls »Erholung«, der also nach Hause kommt und zu diesem Zweck als erstes seinen Fernsehapparat andreht, nur damit irgend etwas läuft, damit etwas los ist - wie in der eben verlassenen Tretmühle des Arbeitsalltags -, und der dann dumpf und stur vor dem Apparat sitzen bleibt, hypnotisiert wie das Kaninchen vor der Schlange, der macht gewiß den allerschlechtesten und unseligsten Gebrauch von diesem Gerät. Er benützt den Fernsehapparat, um mit ihm die Freizeit totzuschlagen, und dafür sollte uns die Freizeit eigentlich zu kostbar sein.
.
Ja, ein schwerwiegendes Problem
Wir stehen hier vor einem sehr schwerwiegenden Problem. Einer ganzheitlichen Betrachtungsweise bedeutet Freizeit nicht einfach das Gegenteil von Arbeitszeit. Im Zeichen eines umfassenden Kulturverständnisses beginnt Kultur schon am Arbeitsplatz.
Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des Menschen dürfen aus dem Bereiche der Arbeit nicht ganz ausgeschlossen und allein in den Bereich der Freizeit verlegt werden.
Der Mensch, der seine Arbeitswelt völlig erschöpft, abgekämpft, übermüdet, abgestumpft, frustriert, entnervt und vergrämt verläßt, wird in seinem Freizeitbereich kaum mehr für ernsthafte und anspruchsvolle, Aufmerksamkeit und Konzentration erfordernde Dinge ansprechbar sein; er wird infolgedessen auch im Fernsehprogramm nur noch das sogenannte Rekreative, das Entspannende, das Ablenkende, das Zerstreuende und Vergnügsame suchen.
Es ist daher reichlich illusorisch, vom Menschen zu verlangen und zu erwarten, er habe in seiner Freizeit hohe Ansprüche an das Fernsehen zu richten, solange es nicht gelingt, die Arbeitswelt noch stärker zu humanisieren. Die Art und Weise, wie wir die Arbeitswelt gestalten, hat mit Kultur nicht weniger zu tun als etwa die Gestaltung eines Theaterspielplans oder eines Konzertprogramms.
So häßlich in seiner sprachlichen Form, so zutreffend ist seinem Inhalt nach der Satz: »Kultur ist, wie der ganze Mensch lebt.« Also nicht nur der Freizeitmensch, sondern auch der Arbeitsmensch.
.
Das Fernsehen - Schuldiger oder Leidtragender
Das Fernsehen trägt an dieser überaus ernsten Problematik keine Schuld; es ist allenfalls Leidtragender, denn es muß sich mit seinen Programmen einigermaßen auf die jetzige Situation seiner Zuschauer einstellen. Das Fernsehen als exponiertes Kommunikationsmedium erweist sich als eine Art Kristallisationspunkt für sehr viele Umwelt- und Gesellschaftsprobleme der Gegenwart. Es schafft diese Probleme nicht selbst, aber es bringt sie zum Vorschein.
Es sei in diesem Zusammenhang nur beispielshalber daran erinnert, daß heute oft mehr noch als der Arbeitstag selber der Weg zur und von der Arbeit den Menschen kaputtmacht. Wer heute zu bestimmten Stunden in eine Stadt hineinfahren oder eine Stadt verlassen will, muß mit zermürbenden Schleich- und Wartezeiten rechnen.
Der Verkehr ist aufreibend geworden für Auto-, Tram- und Busfahrer, für Velofahrer und Fußgänger. Wer sich täglich mehrmals durch die Verkehrshölle mit ihrem Gestank und Lärm (dieser Artikel ist aus 1979 !!) , mit ihren gegenseitigen Rücksichtslosigkeiten und Gefahren, mit ihrem Herz- und Nervenzerschleiß kämpfen muß, der ist abends allein hiervon ziemlich erledigt, und wenn er nach Hause kommt, ist eine Fernsehsendung über die Vor- und Nachteile der Mehrwertsteuer oder über die Grundlagen der Kybernetik ungefähr das letzte, was er sich wünscht.
.
Weg mit den immer gut gemeinten Ratschlägen
Darum hilft es wenig, wenn wir dem Menschen raten, er solle sich sein persönliches Fernsehprogramm sehr sorgfältig auswählen und er solle im Fernsehapparat nicht nur ein Instrument zur leichten Unterhaltung sehen, sondern auch eine wertvolle Möglichkeit zur Information, zur Vermehrung seiner Kenntnisse, zur Auseinandersetzung mit politischen, sozialen, wirtschaftlichen, weltanschaulichen und künstlerischen Problemen unserer Zeit.
Und es hilft wenig, wenn wir sagen, die Erziehung zum richtigen Umgang mit dem Medium, die schon in der Familie und in der Schule einzusetzen habe, sei wichtig und unerläßlich. Dies sind gutgemeinte Ratschläge, die so lange an der Realität vorbeigehen, als das Medium im Sinne des altrömischen Spruches »panem et circenses« zuerst und vor allem zur bloßen »Erholung« vom Arbeitsalltag und von all den modernen Umweltsplagen dient. Unter diesen Umständen wird das Fernsehen seine Aufgabe als aktivierendes Freizeitmedium nie voll erfüllen können.
.
Der Übergang vom Arbeitsbereich zum Freizeitbereich
Die Verbesserung des Verhältnisses von Arbeitsbereich und Freizeitbereich liegt allerdings nur zu einem geringen Teil in der Macht des Fernsehens. Darum bleibt ihm zur Zeit kaum eine andere Möglichkeit, als sich in den Strukturen seiner Programme diesen Gegebenheiten weitgehend anzupassen und den schwierigen Weg zwischen Skylla und Charybdis zu suchen, das heißt: zwischen den (oft fragwürdigen) Wünschen und Erwartungen eines Publikums, das im Fernsehen hauptsächlich ein Betäubungsmittel sieht, und den (oft übertriebenen) Forderungen nach vermehrter Information und Bildung, wie sie von politisch und kulturell engagierten Kreisen an das Fernsehen gerichtet werden.
In dieser ungelösten, paradoxen Situation wird das Fernsehen immer wieder heftigen Kritiken ausgesetzt sein, die allerdings so lange nur sehr wenig zu bewirken vermögen, als das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit in der heutigen Sackgasse steckt.
Trotzdem kann und soll das Fernsehen dem Zuschauer immer wieder vielseitige und sehenswerte Programmangebote machen, damit seine Zeit vor dem Apparat nicht nur vertrödelte Zeit sei, und es soll ihm Anregungen bieten zu einem sinnvollen Umgang mit der Freizeit.
.
Es sind widersprüchliche Aufgaben für "das Fernsehen"
Das Fernsehen hat die widersprüchliche Aufgabe, sich gewissermaßen selber aus dem oft süchtigen Interesse seiner eigenen Zuschauer zurückzunehmen, damit dem Zuschauer vermehrt Zeit frei werde für andere Aktivitäten, die der kulturellen Bereicherung des einzelnen dienen.
Es soll sich weniger als Freizeiterfüller verstehen denn als Anreger zu eigener Freizeitbeschäftigung. Je größer die Freizeit des Menschen in Zukunft wird, um so wichtiger wird diese Aufgabe des Fernsehens. Sie kann aber wiederum nicht vom Fernsehen allein erfüllt werden, sie bedarf eines Zuschauers, der gewillt ist, solche Impulse und Anstöße aufzunehmen und sie in eine eigenständige kulturelle Haltung und in ein selbsttätiges kulturelles Handeln umzuwandeln.
.
Sündenbock und Allheilmittel
.
Das Fernsehen wird gerne zum Sündenbock gemacht
Man macht das Fernsehen gerne zum Sündenbock für alles: Es ist schuld daran, wenn die Brutalität in der Gesellschaft zunimmt, wenn weniger Bücher gelesen werden, wenn infolge bewegungslosen Herumsitzens vor dem Apparat die Volksgesundheit Schaden leidet; es hat das Kinosterben gefördert, den Theaterbesuch vermindert, die Volkshochschulen gefährdet, die dörfliche Kulturgemeinschaft zerstört usw.
Es wäre noch zu prüfen, inwieweit alle diese Vorwürfe berechtigt sind. Eine gewisse Gefährdung kultureller Veranstaltungen durch das Fernsehen ist gewiß nicht ganz auszuschließen.
Anderseits wird das gleiche Fernsehen immer wieder auch zum Allheilmittel gegen solche und ähnliche Probleme emporstilisiert: es soll die politische Mitarbeit des Bürgers neu wecken, zum Bücherlesen anspornen, zum Theater- und Kinobesuch animieren, der Vereinzelung und Vereinsamung entgegenwirken, ja sogar, was schon ernsthaft gefordert wurde, die Selbstmordziffern senken helfen.
Ohne Zweifel können und werden auch solche positiven Auswirkungen immer wieder vom Fernsehen ausgehen. Doch hängt es weitgehend vom einzelnen Zuschauer ab, ob er sich durch Fernsehsendungen aktivieren oder passivieren läßt.
Das Fernsehen ist weder Sündenbock noch Allheilmittel, und es ist beides zugleich. Es ist aber nur ein Instrument unter vielen, die eine kulturelle Aufgabe, Verpflichtung und Funktion haben. Im Rahmen eines aktiv verstandenen, umfassenden Kulturbegriffs hat es - neben andern Medien wie Radio, Presse, Buch, Schallplatte, Kassette - einen ganz bestimmten Stellenwert. Man soll ihn nicht überschätzen und das Medium nicht überfordern, man soll seine Möglichkeiten und seine Grenzen kennen und anerkennen. Man soll es nicht verhimmeln und nicht verteufeln; es ist Fluch und Segen zugleich.
.
Das Fernsehen ist jetzt da, unwiderruflich da
Wir können das Fernsehen nicht mehr rückgängig machen; es ist da, und es verändert unsere Welt. Es liegt an uns allen, an den Fernsehmachern ebenso wie an den Zuschauern, ob es eine Veränderung zum Guten oder zum Schlechten für jeden einzelnen wie für die ganze Gesellschaft werde. »Fernsehen und Kultur« - das Thema wird nie zur Ruhe kommen und nie zu Ende besprochen sein, jedenfalls so lange nicht, als es Kultur noch gibt.
FERNSEHEN UND BILDUNG
.
Das Fernsehen als Bildungsfaktor
Das ist ein beliebtes Thema für medienpädagogische Vorträge, Diskussionen und Fachzeitschriften. Man nennt es mit Vorliebe ein »brennend aktuelles« Thema und schreibt ihm sogar bildungspolitisch entscheidende Bedeutung zu. »Das Fernsehen ein Bildungsfaktor.« Punktum.
Störend daran ist zunächst einmal der Punkt. Er müßte meines Erachtens durch ein Fragezeichen ersetzt werden. »Das Fernsehen als Bildungsfaktor?« Die Frage führt in weitläufige und weitverzweigte Bereiche.
Bildung ist. . .
Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit dem Begriff »Bildungsfaktor«. Man weiß, wie fragwürdig es ist, den vagen und allumfassenden Begriff »Bildung« allgemeingültig und verbindlich definieren zu wollen. Dennoch muß man sich auf ein gewisses gemeinsames Verständnis dieses Begriffs einigen, wenn man nicht heillos aneinander vorbeireden will.
.
- Anmerkung : Das ist also der 3. Begriff, bei dem man mit einer versuchten Definition arg ins Schleudern kommt. Nämlich bei "Gerechtigkeit" (1) und bei "Wahrheit" (2) fängt es an. Es gibt auch da viele Ansätzen, die jedesmal in persönlichen Meinungen enden, nie in einer ernsthaften Definition. Probieren Sie es mal, alleine nur diese 2 Begriffe zu beschreiben .......
.
Was ist mit Bildung gemeint?
Die zahllosen Bemühungen, Bildung zu definieren, sind verbunden mit Namen wie Humboldt und Hegel, Pestalozzi und Herbart, Justus Moser und Kant, Nietzsche und Dewey, Litt und Kerschensteiner, Jaspers und Spranger, Adorno, Guardini usw.
Es kann einem schwindlig werden beim Zusammentragen der verschiedenen Bildungsdefinitionen, und man fühlt sich am Ende »so klug als wie zuvor«.
Dennoch muß versucht werden, eine einigermaßen praktikable Umschreibung zu geben; anders ist dem Thema »Das Fernsehen als Bildungsfaktor« nicht beizukommen. Für unsere Zwecke könnte man es etwa so umreißen:
.
- Bildung ist nicht Erziehung, hat aber mit Erziehung etwas zu tun.
- Bildung ist nicht Schulung, hat aber etwas mit Schulung zu tun.
- Bildung ist nicht Berufsausbildung, hat aber etwas mit Berufsausbildung zu tun.
- Bildung meint jedenfalls nicht nur einen Teil des Menschen - Kopf, Herz oder Hand -, sondern den Menschen als Ganzes.
- Bildung entsteht aus einem Zusammenspiel von Charakter, Wissen, Intelligenz, Gefühl, Vernunft, Verstand und Können.
- Bildung ist also nicht etwas Statisches, sondern etwas Dynamisches, ein lebenslang andauernder Prozeß, der sich innerhalb und außerhalb der Lehr- und Lernstätten abspielt.
- Bildung betrifft den Menschen als Individuum, als Persönlichkeit, hat also etwas mit seinem Selbstverständnis und seiner Selbstverwirklichung zu tun.
- Bildung betrifft aber auch das Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft, hat also auch etwas zu tun mit unserem Gesellschaftsverständnis und mit unserer Gemeinschaftsfähigkeit.
.
educatio und eruditio
Die Antike, wenn sie von Bildung sprach, unterschied zwischen educatio und eruditio. Wobei educatio wörtlich mit Aufzucht zu übersetzen ist, also eine Disziplinierung, Zivilisierung und Moralisierung des Menschen meint. Und eruditio bedeutet wörtlich: Entrohung, was etwa dasselbe meint wie cultura, insbesondere die cultura animi Ciceros, die Kultivierung des inneren Menschen, der Seele wie des Geistes.
Entscheidend ist, daß die Education eine Sache der Führung und des Umgangs miteinander ist und sich im wesentlichen auf die Haltung (ethos) und auf die Sitten (mores) bezieht, während die Erudition, die Bildung im engeren Sinne, eine Sache der Ausbildung, der Schulung und der Schule ist und sich auf Sprache und Denken, Gesellschaft und Welt, Künste und Wissenschaft bezieht.
Bildung und Kultur sind beinahe auswechselbar. Darum hängt die moderne Theorie der Bildung im einen oder anderen Sinne eng mit der modernen Kulturkritik zusammen.
Dies sind einige der wichtigsten Kriterien, die quer durch nahezu alle Bildungsdefinitionen laufen. Betrachten wir, probehalber, ein paar Bildungsdefinitionen im Lichte dieser Umschreibung.
.
»Die geistige Situation der Zeit« (1933)
In seiner berühmten Schrift »Die geistige Situation der Zeit« (1933) formuliert es Karl Jaspers so: »Bildung ist Lebensform; diese hat zu ihrem Rückgrat Disziplin als Denkenkönnen und zu ihrem Raum geordnetes Wissen . . . Der Mensch kommt mit dem Wissen seines Seins über sein nur gegebenes Dasein hinaus.«
Nicolai Hartmann betont im Buch: »Das Problem des geistigen Seins« (1933) noch etwas stärker die Arbeit, die von jedem auf dem Wege zur Bildung zu leisten ist, indem er sagt: »Mensch im vollen Sinne seiner geschichtlichen Epoche ist der einzelne erst, wenn er bewußt in der gemeinsamen geistigen Atmosphäre miterleben kann, wenn er begreifend teilhat an dem, was die Führenden auf den verschiedenen Gebieten des Erkennens laufend erarbeiten . . . Am Lernen und Teilgewinnen, an der Bildung des verarbeitenden Begreifens hängt seine Menschwerdung.«
Für Eduard Spranger in seiner Schrift »Das deutsche Bildungsideal der Gegenwart« (1928) ist Bildung »die durch Kultureinflüsse erworbene, einheitliche und gegliederte, entwicklungsfähige Wesensformung des Individuums, die es zu objektiv wertvoller Kulturleistung befähigt und für objektive Kulturwerte erlebnisfähig (einsichtig) macht«.
Und schließlich hat der Deutsche Ausschuß für Erziehungs- und Bildungswesen 1960 ein Gutachten veröffentlicht unter dem Titel »Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung«, worin es heißt: »Gebildet im Sinne der Erwachsenenbildung wird jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesellschaft und die Welt zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu handeln.«
.
Es ist bemerkenswert, daß hier das Selbstverständnis mit dem Handeln verknüpft wird. Als weiteres grundlegendes Element wird in dieser Erläuterung des Bildungsbegriffs die Erfahrung genannt: »Obwohl Bildung der Bücher bedarf«, heißt es in dem Gutachten, »und nicht ohne Anstrengung des Denkens entsteht, beruht sie doch wesentlich auf den unvertauschbaren eigenen Erfahrungen, die der einzelne auf allen Stufen seines Lebens macht ... Er vermag nur durch solche Erfahrungen zusammen mit dem, was er erlernt und von anderen übernimmt, Gestalt zu gewinnen.«
.
Das Fernsehprogramm als Ganzes
.
Die Rolle des Fernsehens im Bildungsprozeß
Erziehung, Schulung, Wissen, Lernen, Begreifen, Selbstverständnis, Gemeinschaftsfähigkeit, Denken, Können, Erfahrung - das sind ein paar Stichwörter, die wir aus unseren ersten Überlegungen gewonnen haben und die uns auf unseren weiteren Gedankenwegen begleiten werden, wenn wir nun der Frage nachgehen, welche Rolle denn das Fernsehen in diesem Bildungsprozeß spiele und ob es überhaupt ein Bildungsfaktor sein könne.
Hier ist noch eine Vorbemerkung vonnöten: Die pädagogischen Medientheoretiker pflegen zu unterscheiden zwischen sogenanntem »direct teaching« und »enrichment«.
Unter »direct teaching« versteht man kursorisch belehrende Sendereihen, in denen nach allen Regeln methodischer und didaktischer Kunst ein ganz bestimmtes Wissenspensum vermittelt wird.
Das »Telekolleg« der deutschen dritten Programme ist ein Musterbeispiel dafür. In Serienform wird hier über Physik und Chemie, über Biologie, Geographie und Geschichte, über Mathematik und Elektronik doziert, und man kann sich in Fernsehkursen gewisse Fertigkeiten aneignen: Sprachen zum Beispiel, aber auch Stenographie oder rationelle Haushaltsführung.
»Enrichment«-Sendungen hingegen sind keine streng geschlossenen Kursprogramme. Es sind locker und lose gefügte Sendereihen, regelmäßige Kinder- und Jugendsendungen zum Beispiel, Ehe-, Familien- und Erziehungsmagazine, in denen allgemeine Probleme des Lebensalltags zur Sprache kommen.
Oder es sind mehr oder weniger lehrhaft und mehr oder weniger unterhaltsam gemachte Einzelsendungen, die der Lehrer zur Bereicherung seines Unterrichts in seinen Lehrplan einbeziehen kann oder die in unverbindlicher Form der Erwachsenenbildung im weitesten Sinne dienen wollen.
.
Unsere Fernsehtheoretiker
Bildungsfrohe und bildungsfreudige Fernsehtheoretiker machen es sich oft leicht und ziehen nur diese Art von Sendungen in Betracht, wenn es gilt, Wert und Wirkung des Fernsehens als Bildungsfaktor zu beschreiben, zu beweisen und zu rühmen.
Ich weigere mich aber, das Problem auf derart beschränkte Weise zu sehen. Bildung im Fernsehen, Fernsehen und Bildung - dieses Thema kann nicht isoliert, nicht losgelöst vom gesamten Informations- und Unterhaltung sauf trag des Fernsehens betrachtet werden.
Das Fernsehen ist zunächst einmal ein Informationsmedium wie das Radio und die Zeitung. Es wird von Journalisten gemacht, die Nachrichten und Berichte über Vorgänge und Ereignisse vermitteln, die Dokumentationen zu aktuellen Themen und Problemen gestalten.
Das augenblicklich Wichtige geht ihnen über das zeitlos Richtige. Der Journalist ist der sachorientierten Information verpflichtet; er will - wenn er seine Aufgabe richtig erfaßt - nicht Schulmeister der Nation und der Gesellschaft sein. Er wird sich nicht anmaßen, die Grenzen zu überspringen, die durch Begriffe wie »Bildung« und »Erziehung« gezogen sind.
.
Die Erwartungshaltung der Zuschauer
Anderseits erwartet der Zuschauer mehr als von jedem anderen Medium, daß ihm das Fernsehen etwas zur Unterhaltung, zur Entspannung, zur Zerstreuung biete, Sendungen, die ihm zur Erholung und zur Ablenkung vom strengen Arbeitstag dienen.
Der Show-Charakter dieses Mediums macht das Fernsehen für Sendungen dieser Art besonders geeignet: Unterhaltungssendungen mit beliebten Sängerinnen und Sängern, mit Stars von Bühne und Film und mit charmanten Präsentatoren, Quizsendungen mit lohnenden Wettkämpfen um ansehnliche Siegerprämien, aber auch Kriminalfilme, Schwanke, Fernsehspiele und Spielfilme und nicht zuletzt Sportübertragungen.
Die Zuschauermassen verlangen und erwarten das vom Fernsehen, und das Fernsehen als Massenmedium, - das gerne um die Massen buhlt -, kommt diesen Wünschen entgegen. Ich will diese Wünsche nicht gänzlich verurteilen, sie sind durchaus berechtigt, und wir dürfen sie nicht einfach aus unseren Überlegungen streichen, wenn wir das Fernsehen als Bildungsfaktor untersuchen.
.
Umfassende Betrachtung des Fernsehens
Wenn wir Bildung nicht allein und ausschließlich als Schulung verstehen - und es wäre falsch, wenn wir es täten -, müssen wir das Fernsehen als Ganzes betrachten.
Die Leute sitzen durchschnittlich zwei, drei und vier Stunden täglich vor dem Apparat und konsumieren alles andere als »Bildungssendungen«. Aber gerade darum bleibt das Fernsehen nicht ohne Einfluß auf die Bildung bzw. Unbildung und Verbildung großer Zuschauermassen.
Deshalb müssen wir stets das gesamte Fernsehprogramm im Auge behalten, wenn wir vom Fernsehen als Bildungsfaktor reden. Alles andere wäre zweckoptimistische Vogel-Strauß-Politik.
.
Vereinzelung und Vereinsamung
.
Fernsehen ein Bildungsfaktor ?
Ist das Fernsehen, so aufs Ganze gesehen, überhaupt ein ernstzunehmender Bildungsfaktor? - Meine Antwort wird die fernsehgläubigen Bildungstheoretiker vermutlich enttäuschen; denn ich bin nicht der Meinung, daß das Fernsehen ein wesentlicher Bildungsfaktor sei; ich bin nicht der Meinung, daß das Fernsehen im Bildungsprozeß eine entscheidende Rolle spiele.
Ich bin vielmehr der Meinung, daß das Fernsehen als Bildungsfaktor immer noch von zuvielen Leuten überschätzt wird, ja daß das Fernsehen, bei falschem Gebrauch, der Bildung eher hinderlich ist.
Einen Hauptgrund dafür sehe ich in der Isolationsgefahr des Fernsehens. Weil die Leute wegen des Fernsehens mehr und mehr zu Hause sitzen, vernachlässigen sie den Kontakt mit den Mitmenschen. Einwohner des gleichen Quartiers, der gleichen Gemeinde sehen sich immer seltener und kennen einander kaum mehr. Sie werden sich fremd und beschäftigen sich immer weniger mit gemeinsamen Problemen; der einzelne wird immer stärker isoliert.
Durch diese Isolation sind die Familienmitglieder zur Befriedigung ihrer seelischen Bedürfnisse viel stärker aufeinander angewiesen. Die Ehepartner sind aber oft nicht fähig, diese größeren psychischen Bedürfnisse des anderen zu befriedigen; und so kommt es zur Entfremdung. Diese endet oftmals in der Scheidung.
Das amerikanische Fernsehen zerrüttete 1972, gemäß Feststellung einer juristischen Zeitschrift in New York, 165.000 Ehen.
Richter Tipped, ein bekannter amerikanischer Jurist, hat gesagt, das Fernsehen sei ein eigentlicher »Eheräuber«, gegen den man bisher kein wirksames Mittel gefunden habe; dem Fernsehen sei ein erheblicher Einbruch in die Intimsphäre gelungen.
Das Isolierende, das Vereinzelnde, das Vereinsamende des Fernsehens macht es als echtes Bildungsinstrument fragwürdig. Denn der Bildungsprozeß ist immer ein dialogischer und dialektischer Vorgang; er vollzieht sich in der Begegnung und in der Auseinandersetzung zwischen Individuen.
.
Ein Blick auf die "Erziehung"
Erziehung zum Beispiel spielt sich nicht im einzelnen unter einer Glasglocke ab, sie ereignet sich in zwischenmenschlichen Kontakten: zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen den Angehörigen einer Gesellschaft überhaupt.
Und Erfahrung als wichtiges Element der Bildung ist vor dem Fernsehapparat nicht möglich. Das Fernsehen läßt uns bestenfalls passiv an den Erfahrungen anderer Menschen teilnehmen und gibt uns die gefährliche Illusion eines Erfahrungsschatzes aus zweiter und dritter Hand. Es sind Scheinerfahrungen, Ersatzerfahrungen, die wir nie am eigenen Leibe gemacht haben und die darum wertlos bleiben.
Auch in der reinen Sachorientierung, in der bloßen Wissensvermittlung erschöpft sich der Bildungsvorgang nicht. Er gewinnt seinen Sinn erst durch Wertvorstellungen und Überzeugungen, die sich letztlich in Haltungen und Handlungen kundtun. Dazu ist die unmittelbare Kommunikation zwischen Individuen unentbehrlich.
Es kann sich einer durch fleißiges Bücherlesen einen immensen Haufen Wissen in seinem Kopf ansammeln; aber das ist null und nichts wert, wenn dieses Wissen nicht zu organischen Zusammenhängen, zu geprüften Wertvorstellungen und persönlichen Überzeugungen führt. Diese Prüfung findet in der Konfrontation mit anderen Ansichten und Meinungen statt, und dazu bedarf es der Möglichkeit zu zwischenmenschlicher Auseinandersetzung.
Das Wissen muß in der Esse des Denkens geschmiedet werden. Und fruchtbares Denken braucht dringend die Konfrontation mit anderen Denkmöglichkeiten.
Es ist schon fraglich, ob das Fernsehen für die Vermittlung von reinem Bildungswissen das geeignete Medium sei; und wo der Bildungsprozeß über diese bloße Wissensvermittlung hinausgeht, fällt das Fernsehen erst recht aus. Denn dieser Bildungsprozeß verlangt unbedingt den zwischenmenschlichen Kontakt - den das Fernsehen nicht bieten kann. Das Fernsehen als Einwegmedium ermöglicht diesen dialogischen und dialektischen Vorgang nicht, es beläßt das Individuum in seiner Vereinzelung und Vereinsamung, es steht der unmittelbaren Auseinandersetzung zwischen Individuen im Wege.
.
Wissen ist noch nicht Bildung
.
Wissen - ein Element der Bildung
Wissen ist ohne Zweifel ein Element der Bildung. Nicht unbedingt Vielwissen. Wesentliches und vertieftes Wissen ist wichtiger und wertvoller als ein wirrer Haufen von Wissenskleinkram.
Wie aber eignet man sich Wissen an? Wie prägt man sich Wissen ein? Wie vertieft man Wissen? Wie lernt man, notwendiges und unnötiges Wissen voneinander zu unterscheiden?
In pädagogisch und methodisch aufgebauten und gestalteten Fernsehsendungen - z. B. in Schulfernsehsendungen oder in Telekollegkursen - bietet das Fernsehen Wissensstoff an. Eine solche Sendung läuft zu einer bestimmten Stunde vor Tausenden von Zuschauern ab.
Diese Tausende von Zuschauern unterscheiden sich voneinander sowohl durch ihre persönlichen Charakteristika als auch durch das soziale Milieu, dem sie entstammen und in dem sie leben. Denken wir nur an die sehr unterschiedliche Auffassungsgabe.
Der eine nimmt einen Stoff rascher auf, der andere langsamer. Das braucht nicht unbedingt auf einen Begabungs- oder Intelligenzunterschied hinzudeuten. Die Fernsehsendung aber nimmt auf diese unterschiedlichen Auffassungsgaben keine Rücksicht.
Der Zuschauer, der etwas nicht begriffen hat, kann keine Zwischen- und Rückfragen stellen; er kann auch nicht, wie bei einem Buch, etwas länger über einer komplizierten Stelle verweilen, er kann nicht zurückblättern. Je mehr solche unbegriffenen Stellen offenbleiben, um so mehr leidet der Zusammenhang. Der Zuschauer ist zunächst verzweifelt, dann entmutigt, und schließlich steigt er aus der Sendung aus.
..
Beispiel Sprachkurse
Man kann diesen Vorgang zum Beispiel bei Sprachkursen sehr genau verfolgen. Als das Schweizer Fernsehen einen Russischkurs zeigte, wurden vom ersten Lehrbuch 10.000 Exemplare verkauft; vom dritten Buch waren es nur noch etwa 2.000 Exemplare.
Der Lernstoff war sehr schwierig, zur fremden Sprache kam noch die fremde Schrift. Der unerbittlich abrollende Kurs überforderte die Mehrzahl der Zuschauer.
.
Jede Menge von Fragen stellen sich
Dies ist die eine Seite des Problems. Und dies die andere: Wissen soll ja nicht nur oberflächlich aufgenommen, sondern eingeprägt werden. Dazu sind Wiederholungsübungen nötig. Das heißt: Wissen kann nicht ohne intensive Eigenleistung einfach ab Bildschirm konsumiert werden.
Der Lernprozeß verlangt eine Anstrengung, die das Fernsehen niemandem abnehmen kann. Wer bringt und hält diesen Willen zur Anstrengung beim Zuschauer in Gang? Wer führt mit dem Lernwilligen Übungen durch? Wer kontrolliert diese Übungen? Wer nimmt Prüfungen ab, die den Zwischenstand des Wissens feststellen, auf dem die weitere Schulung aufgebaut werden kann?
Abgesehen davon müssen wir uns heute fragen: Ist ein großes Stoffwissen überhaupt noch ein erstrebenswertes Ziel? Das Gesamtwissen unserer Zeit ist derart übergroß geworden, daß es ein einzelner gar nicht mehr zu fassen vermag. Jeder Gymnasiast von heute weiß zehnmal, hundertmal mehr als der gelehrte Erasmus von Rotterdam. Aber ist auch jeder so klug und weise wie er, so gebildet?
Wen nennen wir einen gebildeten Menschen
Es ist darum heute völlig sinnlos, ein möglichst umfassendes Bildungswissen vermitteln zu wollen. Viel wichtiger ist es, dem Menschen von heute Techniken und Methoden beizubringen, wie er sich jederzeit das jeweils gerade benötigte Wissen rasch herbeischafft und aneignet. Und dann muß er fähig sein, Stoffzusammenhänge zu erkennen und herzustellen, damit er die Welt, in der er lebt und arbeitet, begreift, damit er Verantwortung übernehmen und Menschlichkeit praktizieren kann.
Einen solchen Menschen erst nennen wir einen gebildeten Menschen.
In diesem Sinne ist der Bildungsprozeß auch ein Reifungsprozeß, der sich nie und nimmer im vereinzelten Menschen abspielen kann, der als einsamer Rezipient im stillen Kämmerlein vor seinem Fernsehapparat sitzt und sich mit Wissensstoff beträufeln läßt.
.
»Erfüllungsgehilfe des Staates«
.
Das Medium Buch, Schallplatte, Tonbandkassette zum Fernsehen
Die Bildungsfachleute beim Fernsehen haben dieses Problem natürlich früh erkannt. Man bemühte sich um eine Lösung und schuf den sogenannten »Medienverbund«. Man fügte zum Fernsehen das Medium Buch und das Medium Schallplatte oder Tonbandkassette hinzu. Das Begleitbuch zur Fernsehsendung enthält außer dem Wissensstoff auch Übungen zu den einzelnen Stoffgebieten.
Es zeigte sich aber sehr bald, daß auch dies nicht genügte. Zur Assimilierung des Bildungsstoffes gehören außer der Vertiefung durch Lektüre, außer wiederholten Übungen, außer schriftlicher Verarbeitung, außer Korrekturen und Prüfungen auch und vor allem das Gespräch, die Diskussion, die Klärung in Frage und Antwort, das Gespräch mit dem Lehrer, mit dem Mitschüler, mit dem Mitmenschen.
Man wurde sich des großen und unentbehrlichen Wertes bewußt, den die Begegnung zwischen Lehrern und Lernenden in diesem Medienverbund hat, und man schuf die »Face-to-face-Gruppen«, in denen die Lernenden von Zeit zu Zeit mit Lehrern zusammenkommen und das Gelernte in Übungen und Gesprächen auf die Probe stellen, es vertiefen, korrigieren und erweitern.
Und damit landete man wieder bei der ganz gewöhnlichen Schule mit Schülern und Lehrern, einer Schule, in der das Fernsehen letzten Endes nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.
Die persönlichen Begegnungen zwischen Schülern und Lehrern
Hatte man in einer übertriebenen Fernsehbildungseuphorie diese persönlichen Begegnungen zwischen Schülern und Lehrern zunächst für überflüssig oder nebensächlich erachtet, so sah man nun ein, daß gerade in dieser Begegnung von Angesicht zu Angesicht das A und O aller Bildung liegt. Die Rolle dieser Lehr- und Übungsgruppen wuchs, und das, was in diesem Zusammenhang noch über den Bildschirm lief, verlor an Gewicht und Bedeutung.
Neben dem Fernsehen und durch das Fernsehen enstand also eine eigentliche Schulinstitution. Es kam zur Gründung von Bildungszirkeln, die unabdingbar zu einem richtigen Medienverbund gehören. Die Organisation dieser Zusatzleistung des Medienverbunds erfordert aber einen mächtigen Aufwand an Mitteln und Personal.
Darin sehe ich eine vierfache Gefahr.
.
.
- 1. Es ist höchst fraglich, ob es Aufgabe des Fernsehens sei, seine Mittel für solche Zusatzleistungen einzusetzen. Die Zahl derjenigen, die an einer solchen »Bildung« durch das Fernsehen interessiert sind, ist relativ klein und steht in keinem Verhältnis zum materiellen und personellen Aufwand, den das Fernsehen dafür betreiben muß.
- 2. Es stellt sich sogar die Frage, ob in solchen Fällen nicht Fernsehmittel zugunsten einer verschwindend kleinen Publikumsminderheit zweckentfremdet werden, Mittel, die dann bei der Gestaltung des übrigen Programms fehlen. Und dieser Frage wird man in Anbetracht der Einnahmenstagnation und der rapiden Kostensteigerung beim Fernsehen weniger denn je ausweichen können.
- 3. Selbst wenn all dies möglich wäre - wenn es möglich wäre, gute Schulungsprogramme zu günstigen Sendezeiten auszustrahlen und regelmäßig zu wiederholen; wenn ein umfassender Medienverbund mit Begleitbüchern, mit Arbeitsgruppen und Lehrern, mit Übungen und Prüfungen funktionieren würde; wenn regelmäßige Schulfernsehsendungen mit den Lehrplänen in Übereinstimmung zu bringen wären; wenn alle Mittel zu einer optimalen Gestaltung solcher Schulungsprogramme vorhanden wären -, selbst dann müßte man sich fragen, ob eine solche Vereinheitlichung im Bildungswesen überhaupt wünschbar wäre (eine ganze Nation würde ihr Geschichtswissen nur noch aus dem Munde eines einzigen Historikers beziehen), ob durch diese totale Gleichschaltung nicht eine geistige Verarmung erzeugt würde, ob hier nicht eine Einebnung der Individualitäten durch das Massenmedium Fernsehen geschähe, die einem lebendigen und vielfältigen Bildungswesen viel mehr zum Nachteil als zum Vorteil gereichte.
- 4. Die Überschätzung und der Einsatz des Fernsehens als Bildungsmittel sind auch darum gefährlich, weil die falschen Erwartungen, die man in das Fernsehen setzt, dazu verführen könnten, die anderen, wirklichen Bildungsmöglichkeiten zu vernachlässigen: die Lehrerbildung zum Beispiel, den Ausbau und die Verbesserung des gesamten Schulwesens, die Förderung der Volkshochschulen und aller anderen Institutionen der Erwachsenenbildung. Weil es mit der Schul- und Erwachsenenbildung weitherum schlecht bestellt ist, erwartet man das Heil vom »Fernsehen als Bildungsfaktor«. Und aus dieser Illusion könnte es eines unschönen Tages ein bitterböses Erwachen geben. Das Fernsehen kann und darf auf keinen Fall zum »Erfüllungsgehilfen« des Staates werden, indem es durch bloße Alibi-Bildungssendungen die Versäumnisse des Staates in der Bildungspolitik vordergründig und wirkungslos kompensiert.
.
Hilfestellungen und Serviceleistungen
.
Über die audiovisuellen Hilfsmittel
Im übrigen ist der Einbezug von visuellen und audiovisuellen Hilfsmitteln in den Unterricht keine sensationell neue und revolutionäre Methode. Schon längst bevor es das Fernsehen gab, gab es auf den verschiedensten Stoffgebieten Lichtbilderreihen und Unterrichtsfilme, die der Lehrer je nach Bedarf einsetzen konnte.
Statt von Filmrollen auf eine Leinwand wird solches Anschauungsmaterial künftig ab elektronischen Kassetten auf den Bildschirm projiziert. Das ist der ganze Unterschied. Gewiß werden solche technischen Neuerungen auch zur Neugestaltung und didaktischen Verbesserung der audiovisuellen Unterrichtsmethoden führen; aber eine grundlegende, revolutionäre Umwälzung sehe ich nicht darin, und schon gar nicht ist das Fernsehen entscheidend daran mitbeteiligt.
Wie schon bisher und heute werden die audiovisuellen Hilfsmittel in der Schule und in der Erwachsenenbildung immer eine gewisse Rolle spielen. Aber unabhängig von Fernsehanstalten und Fernsehprogrammen. Es werden eigene Institutionen entstehen müssen (und es gibt schon einige), welche Lehrprogramme für Kassetten produzieren und vertreiben.
Die Schulen können sich solche Kassetten ausleihen. Das hat den Vorteil, daß der Lehrer ein Programm immer dann zur Verfügung hat, wenn es in den Ablauf seines Lehrplans hineinpaßt. Die Lehrpläne divergieren in jedem Land von Gegend zu Gegend.
Eine Vereinheitlichung ist kaum möglich und bis zu einem gewissen Grade auch gar nicht wünschenswert. Die direkte Verwendung von Kassetten im Schulzimmer hat überdies den Vorteil, daß der Lehrer das Programm jederzeit unterbrechen und ganz oder teilweise wiederholen kann, je nach Bedarf, vor allem auch in Anpassung an die Auffassungsgabe der einzelnen Klassen und Schüler.
Aber weder die Herstellung noch der Vertrieb solcher Kassetten kann Sache des Fernsehens sein. Es liegt in der Aufgabe des Staates, seinen Schulen solche audiovisuellen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Ein Fernsehapparat und ein Kassettenrecorder gehören heute in jedes Schulzimmer, so selbstverständlich wie früher eine Wandtafel. Aber es wäre absurd, zu verlangen, daß das Fernsehen mit seinen ohnehin überstrapazierten Produktions- und Finanzmitteln diese Hilfen zu liefern habe.
.
Was nicht zu den Aufgaben des Fernsehns gehört
Auf einzelnen Gebieten und in bestimmten Fächern gibt es heute einen Lehrerüberfluß, bei andern einen Lehrermangel. Bildungstheoretiker meinen, audiovisuelle Hilfsmittel könnten für die bloße Stoffvermittlung dort von Nutzen sein, wo Lehrernot herrscht. Man kann sich wirklich fragen, ob man für die bloße Wissensvermittlung immer einen vorzüglich ausgewiesenen Lehrer in Anspruch nehmen soll.
Der Lehrer, wenn er in gewissen Fächern von der reinen Stoff-Vermittlung entlastet wird, wird freigesetzt für Aufgaben, die nur er und niemand anders leisten kann, für die pädagogische Aufbereitung dessen, was durch die audiovisuellen Medien vermittelt werden kann, für die kritische Auseinandersetzung mit dem Stoff.
Aber auch dieses Problem muß außerhalb der Fernsehanstalten gelöst werden.
Ohne Zweifel besteht in Anbetracht des beschleunigten Fortschritts auf allen Gebieten unseres beruflichen Lebens heute und in Zukunft ein großer Bedarf an Fortbildungsmöglichkeiten. Das Wissen eines Wissenschaftlers ist zum Beispiel fünf Jahre nach Abschluß seines Studiums schon weitgehend überholt und veraltet.
Es müssen in vielen Bereichen intensivierte Fortbildungsaktivitäten entfaltet werden. Aber es ist sinnlos, dieses Fortbildungsangebot wahllos und ziellos durch ein Massenmedium wie das Fernsehen in den blauen Äther hinaus zu verschleudern.
Man muß die Adressaten dieses Schulungsangebots genau kennen; um eine erfolgreiche Schulung zu erreichen, müssen Lernwillige mit gleichem Wissensstand in Gruppen zusammengefaßt werden. Diesen Gruppen können die audiovisuellen Hilfsmittel sehr dienlich sein.
Und hier könnte das Fernsehen allenfalls eine gewisse praktische Hilfe leisten, indem es zum Beispiel in regelmäßigen Sendungen über das Angebot an neuen Lehrkassetten informieren würde, indem es audiovisuelle Informationen abgäbe für Private, für Lehrer, für Institutionen der Erwachsenenbildung, für die Fortbildung in Industriebetrieben usw.
Wo die Fernsehanstalten helfen könnten ....
Das Fernsehen könnte unter Umständen auch (gegen Bezahlung durch den Staat) seine Sendeanlagen zur Verfügung stellen, damit in sendefreien Stunden über das Sendenetz fremdproduzierte Lehrprogramme ausgestrahlt würden, die von den Schulen aufgezeichnet werden könnten, damit der Lehrer diese Programme zur Hand hat, wenn er sie im Verlaufe seines Lehrplanes braucht.
Der Einsatz dieser technischen Mittel in den Schulen würde den Staat zwar ein paar Millionen kosten. Aber es gibt vermutlich in jedem Staatsbudget einige Rechnungsposten, die zugunsten solcher Anschaffungen leicht gestrichen werden könnten.
Was zur Bildung und Ausbildung unserer Kinder und Erwachsenen dient, sollte in den Überlegungen jedes Politikers und Staatsmannes oberste Priorität haben.
Aber in solchen Serviceleistungen würden sich meines Erachtens die Möglichkeiten des Fernsehens als »Bildungsfaktor« erschöpfen. Es wäre an der Zeit, daß wir die Grenzen des Fernsehens als Schulungs- und Ausbildungsmittel erkennen und uns nicht länger auf Pfaden bewegen, die sich heute schon als Sackgassen erwiesen haben.
.
Denken, Bilder und Sprache
.
Die Eigenschaften des Mediums Fernsehen nicht überschätzen
Meine kritische Haltung diesem Problem gegenüber gründet jedoch nicht allein in methodisch-pädagogischen und lernpsychologischen Überlegungen. Sie wird auch bestimmt durch das Medium an sich, das gewisse Eigenschaften hat, die es vor allem didaktisch als Bildungsinstrument höchst fragwürdig machen.
Es sind Grenzen des Mediums, die sich nicht nur in eigentlichen Schulungssendungen, sondern in allen Sendungen des Fernsehens bemerkbar machen.
Das Fernsehen ist überaus stark vom Bild abhängig. Eine Binsenwahrheit. Es ist leichter und verlockender, im Fernsehen über Dinge zu berichten, die man im Bilde zeigen kann.
Das Bild ist aber ein leicht verformbarer Rohstoff und hat nur einen recht unscharfen Informationsgehalt. Es erregt weniger unser Denken als unsere Emotionen.
Wir interpretieren es gefühlsmäßig. Der russische Filmregisseur L. W. Kuleschow hat dafür schon 1923 ein berühmtes, eindrückliches Beispiel geliefert (siehe dazu S. 89).
Die emotionelle Wirkung des Bildes ist so stark, daß Wortkommentare von den Bildern oft völlig in den Hintergrund gedrängt werden. Der Eindruck des Bildes lenkt vom Wort ab. Das Fernsehen vermag die Gefühle stärker anzusprechen als den Verstand.
Es ist ein technisch faszinierendes Instrument - seine Sendungen sind aber unablässig von einem Rückgang der intellektuellen Qualität und des rationalen Inhalts bedroht.
.
Über die Wahrnehmung von Bildern und der Sprache
Hier muß ein Wort zu einem Wahrnehmungsproblem gesagt werden. Der Philosoph und Soziologe Georg Simmel, der sich unter anderem damit befaßt hat, wie unser Weltbild im Zusammenhang mit unseren Sinnesorganen zustande kommt, machte die folgende Feststellung:
»Im allgemeinen wird das, was wir von einem Menschen sehen, durch das interpretiert, was wir von ihm hören, während das Umgekehrte sehr viel seltener ist. Deshalb ist der, der sieht, ohne zu hören, sehr viel verworrener, ratloser, beunruhigter als der, der hört, ohne zu sehen.«
Über das Ohr, von der Sprache her - meint Simmel - kann der Mensch viel mehr, vor allem viel subtilere und präzisere geistige Informationen bekommen als über das Auge. Der taube Mensch, der nicht hört, ist darum viel ärmer dran als der Blinde, der zwar nicht fernsehen, aber dafür Radio hören kann.
Da sich das Fernsehen aber notgedrungen immer wieder und vor allem als Bildmedium verstehen muß, kann es auf den Zuschauer mit der Zeit sehr nachteilige Auswirkungen haben. Denn wenn das Fernsehen nur noch darstellen und behandeln wollte, wozu es Bilder gibt, fände etwas vom Wesentlichsten, was den Menschen von den übrigen Säugetieren unterscheidet, im Fernsehen nicht mehr statt, nämlich das Denken.
.
Zum Denken brauchen wir Begriffe.
Um Begriffe zu bilden, brauchen wir die Sprache. Denken kann sich in Sprache umsetzen. Aber es gibt nicht zu allen Gedanken, die der Mensch zu denken imstande ist, genau entsprechende Bilder. Je mehr also im Fernsehen nur noch Bilder gezeigt werden und je weniger im Fernsehen gesprochen wird, um so weniger kann im Fernsehen Denken stattfinden.
Und das heißt - auf unser Thema bezogen -, um so untauglicher erweist sich das Fernsehen als Bildungsfaktor. Eine andere Schwierigkeit sehe ich im Verhältnis des Fernsehens zur Zeit, zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
.
Die Geschichte und die Zukunft in Bildern darstellen ?
Was vor langer Zeit war oder noch nicht ist, was in ferner Zukunft liegt, läßt sich schlecht zeigen. Es läßt sich darüber reden; aber es gibt nur wenige oder überhaupt keine Bilder davon, und das wenige Bildmaterial ist wenig attraktiv. Man weiß, wie hinreißend ein historischer Dokumentarfilm ist, der sechzig Minuten lang alte Stiche und Gemälde, alte Urkunden, Museumsstücke, verfallene Stadtmauern und zerbröckelnde Ruinen zeigt.
Das Fernsehen lebt von der zeigbaren Gegenwart und züchtet geradezu eine Gegenwartsbesessenheit. Es vernachlässigt die Vergangenheit und macht damit den Gegenwartsmenschen wurzellos.
Der Mensch wird aber nie ein richtiges Verhältnis zu sich selbst, zu seiner Gesellschaft, zu seiner Zeit, zu den Problemen der Gegenwart finden, wenn er geschichtliche Ursprünge und Hintergründe nicht kennt. Er wird viele Phänomene der Gegenwart nie richtig verstehen, wird ihnen nie den gehörigen Stellenwert beimessen können und sich ihnen gegenüber nie richtig verhalten, wenn ihm die Kenntnisse und Erfahrungen der Geschichte fehlen.
.
Fragen zum aktuellen Neomarxismus (in 1979)
Wir haben zum Beispiel in jüngster Zeit eine merkwürdige Wiederbelebung des Marxismus erfahren. Wie sollen wir sie deuten und verstehen? Ursprung, System und Entwicklung der marxistischen Philosophie, die Umwandlung des ökonomischen Marxismus in einen psychoanalytischen — all dies müßte dargestellt werden, wollten wir zu den wirklichen Gründen dieses Neomarxismus vorstoßen.
Wie aber soll dies im Fernsehen befriedigend bewerkstelligt werden? Jeder Zeitungsartikel, jedes Taschenbuch, jeder Radio- oder Volkshochschulvortrag ist da einer Fernsehsendung weit überlegen.
Das Fernsehen tut sich schwer mit der Behandlung historischer Themen, mit der Darstellung der Vergangenheit (und der Zukunft). Das liegt im Wesen des Mediums. Es versagt also als Bildungsfaktor gerade auf einem Gebiet, das für die Bildung des Menschen wichtig und unentbehrlich ist, wenn Bildung etwas mit Weltverständnis und Gemeinschaftsfähigkeit zu tun haben soll.
.
Fernsehen - Was es kann und was es nicht kann
.
Fernsehen - das »wahrste« und »glaubwürdigste« Medium
Auch der unabdingbare und unvermeidbare Manipulations-Charakter macht das Fernsehen als Bildungsfaktor so fragwürdig. Sehr vielen Leuten gilt zwar das Fernsehen als das wichtigste und zuverlässigste, das »wahrste« und »glaubwürdigste«, das »objektivste« Medium.
Sie meinen, das Fernsehen vermittle ein wirkliches Bild der Wirklichkeit, weil man nicht einfach glauben müsse, was man im Radio gehört, in der Zeitung oder in einem Buch gelesen habe? Durch das Fernsehen werde man unmittelbarer Augenzeuge. Dies ist eine arge Täuschung.
Der größte Teil aller Filmdokumente ist nicht, wie wir so gerne glauben, »aus dem Leben gegriffen«. Im Fernsehen findet immer und unvermeidlich Manipulation der Wirklichkeit statt.
Es gibt unvermeidbare Manipulationen, die in der Sache oder im Medium selber begründet sind und die nicht unbedingt des Teufels sein müssen. Aber es gibt auch unsachliche, gewissenlose, böswillige Manipulationen, die den Zuschauer über einen Sachverhalt absichtlich falsch und verzerrt informieren, die ihn einseitig beeinflussen und für eine falsche Ansicht gewinnen wollen. Die eine Art der Manipulation ist von der anderen oft kaum zu unterscheiden, (s. das Kapitel »Fernsehen und Manipulation«, S. 65 ff.)
.
Der Manipulationscharakter des Fernsehens
Der Manipulationscharakter des Fernsehens ist um so heikler und bedenklicher, als die Faszinationskraft dieses Bildmediums besonders intensiv ist. Was wir darum dringend brauchen, ist weniger eine Erziehung und Bildung durch das Fernsehen als vielmehr eine Erziehung zum Fernsehen, zum richtigen, wohlüberlegten, beherrschten und kritischen Gebrauch des Mediums.
Das Fernsehen hat seinen großen Reiz und seine interessanten Möglichkeiten, aber es hat auch seine Grenzen. Noch immer werden diese Grenzen nicht hinreichend erkannt. Noch immer erwarten viele Leute vom Fernsehen alles. Es herrscht die naive Vorstellung, durch Druck auf den Knopf könne man jederzeit alles Wünschenswerte gleich zur Hand haben: die totale Information, die totale Unterhaltung und die totale Bildung. Und dies alles im bequemen Selbstbedienungsverfahren, elektronisch gesteuert vom Fauteuil aus.
Man sollte endlich klarer zur Kenntnis nehmen, was das Fernsehen kann und was es nicht kann. Es kann zum Beispiel politische, wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche, soziale Probleme nicht gründlich und vertieft genug darstellen.
Einmal aus zeitlichen Gründen - aus Gründen der Aufnahmefähigkeit des Zuschauers können und dürfen gerade anspruchsvolle Sendungen nicht zu lang sein -, zum andern, weil sich die meisten und gerade die wichtigsten und schwierigsten Probleme nicht allein oder vorwiegend vom Bild her erläutern lassen.
.
Ohne Denken bleibt jedoch alles Anschauen von Bildern nutzlos, hohl und leer.
Das Anschauen von Bildern mag eine gewisse kulinarische Befriedigung bieten; aber es geht nicht von selbst in Denken über. Ohne Denken bleibt jedoch alles Anschauen von Bildern nutzlos, hohl und leer. Das Fernsehen kann aber nicht das Denken lehren.
Es kann allenfalls dem Denken Stoff bieten: durch Informationen, Dokumentationen, Diskussionen, aber auch durch ein Fernsehspiel oder einen Spielfilm. Wenn es hingegen darum geht, weiträumige und vertiefte Zusammenhänge zu zeigen, wird das Fernsehen notgedrungen an der Oberfläche haften bleiben.
Das Fernsehen kann durch seine Sendungen wie kaum ein anderes Medium Interesse wecken an einem Thema, an einem Problem. Es kann durch gewisse Programme zum Beispiel zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung Anstoß geben. Es kann Tausende, ja Millionen von Menschen an einem großen Theater- oder Konzertereignis teilhaben lassen, zu dem die meisten dieser Zuschauer und Zuhörer sonst keinen Zugang hätten.
Aber selbst dann bleibt das Fernsehen eben doch ein Ersatzmedium. Es kann Impulse und Denkanstöße geben. Aber mehr nicht. Wer diese Denkanstöße und Impulse nicht aufnimmt und weitertreibt - durch Lektüre, durch Studium, durch direkte Teilnahme am wirklichen kulturellen Leben -, der wird am Ende zwar einen immensen Bilderhaufen im Kopf haben, den gedanklich zu ordnen und zu bewältigen er aber nicht mehr fähig ist. Und damit hat er gar nichts für seine Bildung getan, aber sehr viel dagegen.
.
Das Fernsehen ersetzt die Bücher nicht
Das Fernsehen ersetzt die Bücher nicht, die Zeitungen und Zeitschriften nicht, nicht den Besuch des Kinos und Theaters, nicht die öffentlichen Vortragsveranstaltungen, nicht den Konzertsaal, nicht die Erwachsenenbildung und die Freizeitkurse, nicht die Schule und den Lehrer, nicht das klärende Gespräch in der Familie und im Freundeskreis.
Wer all dies glaubt vernachlässigen zu können, weil er Abend für Abend einsam schweigend vor seiner Fernsehkiste sitzt und in die Mattscheibe glotzt, wird eines Tages entsetzt feststellen - sofern er dann dazu überhaupt noch in der Lage ist -, daß ihm unter der Dauerberieselung mit Bildern und Tönen die konzentrierte Aufnahmefähigkeit völlig abhanden gekommen und daß seine Denkmaschine völlig verrottet und verrostet ist.
Der Apparat, wenn er nicht mit Zurückhaltung und Disziplin gehandhabt wird, läßt dem Zuschauer gar keine Zeit mehr zur denkenden Auseinandersetzung mit allem Gesehenen. Die Programme folgen sich Schlag auf Schlag.
Der Apparat liefert pausenlos und ungerufen eine Information nach der andern und wirft den Konsumenten in ein Wechselbad von Politik und Krimi, von Sport und Kunst, von Show und Report, von Wildwest und Wissenschaft. Dieser tägliche Programmablauf ist an sich schon denk- und bildungsfeindlich.
.
Erziehung zu kritischem Fernsehen
.
Ändern kann es allein der Zuschauer selbst
Wer aber etwas daran ändern kann, ist allein der Zuschauer selber. Er muß (und zwar schon in der Schule und im Elternhaus) selektiv fernsehen lernen. Er darf sich nicht willenlos dem vielfältigen Angebot überlassen. Er muß auswählen.
Er muß sich vornehmen: Das will ich mir anschauen und das nicht - denn nachher möchte ich mich noch mit meiner Frau darüber unterhalten oder mit meinen Kindern, oder ich möchte noch ein Buch lesen oder eine Schallplatte hören oder einen Brief schreiben.
Das Abschalten des Fernsehgeräts ist im Interesse der eigenen Bildung mindestens so wichtig wie das Anschalten. (Man fragt sich übrigens manchmal, was die Leute eigentlich vor dreißig Jahren jeden Abend so gemacht haben, als es noch kein Fernsehen gab.)
.
Extrem wichtig - die frühe Medienerziehung in der Schule
Und überaus wichtig, ein ganz besonders dringendes Postulat ist die frühe Medienerziehung in der Schule. Der Schüler soll lernen, das Fernsehen nicht nur anzuschauen, sondern zu durchschauen. In eigenen medienkritischen Sendungen für Jugendliche und Erwachsene könnte das Fernsehen, obwohl da und dort schon manches in dieser Richtung geschieht, durchaus noch ein mehreres und wirkungsvolleres zur Medienerziehung seiner Zuschauer beitragen (siehe dazu auch S. 91).
Am Beispiel Englands zeigt es sich, daß wir unsere Erwartungen in das Fernsehen nicht überspannen dürfen. Nach jüngsten Schätzungen gibt es heute noch in Großbritannien zwei Millionen Analphabeten - im Lande Shakespeares also, im Lande Byrons, Bernard Shaws und Bertrand Russells. Und überdies und gerade in einem Lande, das wahrscheinlich wie kein anderes ungeheuer viel für Schulfernsehsendungen und Bildungsprogramme getan hat - mit dem praktischen Erfolg, daß der Analphabetismus, vor allem bei den jüngeren Altersklassen, in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.
Wenn eben Kinder von der Schule weg sich direkt aufs Fernsehsofa sinken lassen, wenn Fünf- bis Vierzehnjährige täglich sechs bis sieben Stunden wahllos vor der »goggle box« (dem Glotzophon) verbringen, dann muß es einen nicht wundern, daß sie am Ende körperlich und geistig erschöpft und für keine Bildungsanstrengung mehr zu haben sind.
Und ebensowenig muß man sich wundern, wenn dann, wie in England, wieder die Meinung um sich greift, die gute alte Schule mit dem guten alten Lehrer könne eben selbst durch das beste Fernsehprogramm nicht ersetzt werden.
Das Fernsehen ist an mancher unguten Entwicklung gewiß mitschuldig; aber meist schafft es die beklagten Probleme der Gesellschaft gar nicht selber, sondern läßt sie nur besonders deutlich zum Vorschein kommen. Soll man aber den Boten töten, der eine schlechte Nachricht überbringt?
.
Eine Wirkkraft, die das Fernshen keineswegs besitzt
Doch auch wer das Fernsehen als Helfer in allen Lebenslagen und Lebensfragen anrufen möchte, mißt ihm eine Wirkkraft zu, die es keineswegs besitzt. Es ist bestimmt auch nicht das probate Mittel zur Überwindung der Bildungskrise der Gegenwart. Wer die Bildungsnöte unserer Zeit durch Fernsehen heilen möchte, wird eines Tages enttäuscht feststellen, daß er sich einem Kurpfuscher anvertraut hat.
FERNSEHEN UND MANIPULATION
.
Die "Manipulation" durch das Fernsehen - was ist das ?
»Wir werden durch das Fernsehen manipuliert« - »Manipulation statt Information im Fernsehen« - »Manipulatoren mißbrauchen das Fernsehen« : Fast täglich kann man diese und ähnliche Schlagworte hören und lesen. Die Meinung ist verbreitet, wir seien die Opfer von Manipulatoren, die an den Machthebeln des Massenmediums Fernsehen selbstherrlich schalten und walten; die große Masse des Volkes oder gar der Menschheit werde von einigen wenigen manipuliert und wir seien hilflos der Manipulation durch jene ausgeliefert, die das Kommunikations- und Informationsinstrument Fernsehen in der Hand haben.
»Manipulation« - wir brauchen das Wort oft selber, und zwar immer dann, wenn es gilt, etwas Verwerfliches zu kennzeichnen, etwas Böses, etwas Unerwünschtes und Verbotenes, etwas Ärgerliches, etwas Perfides, Gemeines und Hinterhältiges.
Kurz: Manipulation erscheint uns als etwas, das nicht sein sollte und nicht sein dürfte, das bekämpft und verhindert werden muß. »Manipulation« - das klingt wie ein Aufschrei, ein Angstschrei, ein Warnruf, ein Fluch, ein Vorwurf, eine Anklage.
Ist dies aber nicht eine recht falsche und oberflächliche Vorstellung von diesem Begriff? Ist dies nicht ein recht gedankenloser, fahrlässiger Umgang mit diesem arg geschundenen Modewort? Ich glaube ja.
Hilft uns diese emotionsgeladene Verwendung des Begriffs zur Erkenntnis und Bewältigung der Probleme, die sich hinter dem Wort »Manipulation« verbergen? Ich glaube nein.
Nochmal : Was ist Manipulation ?
Wir sollten uns, meine ich, fragen, was Manipulation wirklich ist. Nicht, um eine abstrakte, allgemeingültige Definition des Begriffs heraus zu destillieren. Diese Mühe lohnt sich nicht. Denn Manipulation ist kein wissenschaftlicher Begriff, der sich scharf fassen ließe. Es ist ein unseliges Schlagwort, mit dem man mehr Mißverständnisse heraufbeschwört als Verständnis weckt, das mehr zur Verunklärung statt zur Aufklärung beiträgt. Jeder, der von Manipulation spricht oder schreibt, versteht etwas anderes darunter. Eine verbindliche Übereinkunft über den genauen Sinn dieses Wortes besteht nicht.
Dennoch ist es nicht ganz fruchtlos, sich darüber ein paar Gedanken zu machen. Weniger um des hoffnungslos strapazierten Begriffs willen als darum, weil uns das Nachdenken darüber mitten hineinführt in einige zentrale Probleme des Fernsehens, des Fernsehzuschauers, des richtigen Umgangs mit dem Medium auf Seiten der Produzenten wie der Konsumenten, weil sich dabei Möglichkeiten und Grenzen dieses Mediums aufzeigen lassen und nicht zuletzt darum, weil unser Nachdenken über diesen Begriff zwangsläufig in einer Betrachtung über unsere gesellschaftliche Situation enden muß.
.
Menschen handhaben
.
Der sprachliche Ursprung von "Manipulation "
Wenn wir dem Begriff von seinem sprachlichen Ursprung her näherzukommen versuchen, sind wir bald am Ende mit unserem Latein. Ohne Zweifel steckt das lateinische Wörtchen »manus« darin (»Hand«). Und Manipulation könnte übersetzt werden mit »Handhabung«; manipulieren wäre demnach »handhaben«.
Eine Handhabe ist im ursprünglichen Wortverstand ein Handgriff, ein Griff. Etwas handhaben heißt, etwas in den Griff bekommen, etwas in Betrieb, in Dienst nehmen, in Bewegung setzen, etwas betätigen, etwas benutzen und schließlich etwas bewirken.
Solange sich dies auf Sachen, auf Dinge, auf Geräte und Maschinen bezieht, beunruhigt es uns nicht allzusehr. Ungemütlicher wird es uns, wenn es dabei um Menschen geht.
Menschen handhaben, Menschen in den Griff bekommen, Menschen benutzen, bei Menschen etwas bewirken - da werden wir stutzig. Da wird Manipulation zu einer Befürchtung, zu einer Angst. Denn bei dieser Vorstellung steht plötzlich unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung in Gefahr.
Da ist irgend jemand, ein einzelner, eine Gruppe, irgendeine handelnde Instanz, die auf eine größere Zahl von Menschen Einfluß, Macht ausübt und diese Menschen daran hindert, freie, autonome Entscheidungen zu treffen. Manipulation wird zur Vergewaltigung. Manipulation erscheint als Beherrschung des Menschen durch den Menschen, als raffinierte Beeinflussungstechnik, durch die der Mensch restlos gegängelt wird.
So verstanden, hat der Begriff Manipulation einen gefährlich-technischen Beiklang. Er ruft das Bild einer Apparatur, einer Maschinerie hervor, in die wir wehrlos eingespannt und durch die wir gelenkt und gesteuert werden.
.
Manipulation - Ein zwielichtiger Begriff
.
Die Manipulation in der Werbung
Manipulation als Lenkung und Steuerung wird uns am augenfälligsten in der Werbung. Durch die Werbung werde ich dazu gebracht, »mit dem Geld, das ich noch gar nicht habe, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche, um damit Leuten zu imponieren, die ich gar nicht mag«.
Da wird mir eingetrichtert, es sei unmöglich, mit Schuppen auf dem Anzug herumzulaufen; ein ordentlicher und sauberer Mensch, der Erfolg haben wolle in der Gesellschaft und vor allem bei Frauen, tue dies nicht. Man hämmert so lange auf mich ein, bis ich eben eines Tages dieses brandneue, wissenschaftlich erprobte, wirkkräftige und preisgünstige Haarwasser Anti-Schuppin kaufe. Man hat mich manipuliert, bis ich meine Schritte zum Parfumerieladen lenkte.
Aber wenn dies Manipulation ist - ist es dann nicht zum Beispiel auch jede Erziehung? Werden wir nicht in jungen, wehrlosen Jahren durch unsere Eltern auf bestimmte Verhaltens- und Denkweisen hin manipuliert? Oft sehr gegen unseren Willen.
Und in der Schule? Ist nicht auch der Lehrer ein Manipulator an seinen Schülern? Ist sein ganzes Tun nicht auch eine systematische Beeinflussung, Lenkung und Steuerung auf ein Ziel hin, das die meisten Schüler freiwillig kaum anstreben würden?
Und der Pfarrer auf der Kanzel? Er macht uns sogar die Hölle heiß, wenn wir ihm, beziehungsweise den Lehren der Kirche nicht glauben und folgen wollen.
.
Die raffinierte Manipulation
Und die Parteien und Verbände - bei Wahlen und Abstimmungen -, versuchen sie nicht auch, auf ebenso raffinierte wie massive Weise unsere Meinung zu beeinflussen und unseren Entscheid als Stimmbürger zu ihren Gunsten zu manipulieren?
Ja selbst die Regierung schickt gelegentlich einen Vertreter ans Radio und auf den Bildschirm. Er soll bei gefährdeten Abstimmungsvorlagen dem Stimmbürger die Katze den Buckel hinaufjagen, damit er Angst bekommt vor einem negativen Entscheid. Ist das nicht auch Manipulation?
Und verfügt nicht auch die Gesellschaft über enorme manipulative Kräfte? Zwingt sie mich nicht durch ihre Normen und Konventionen zu einem konformen Verhalten? Wenn ich nicht gesellschaftsfeindlich erscheinen will, ist mir kaum erlaubt, an diesen Konventionen zu zweifeln, geschweige an ihnen zu rütteln.
Willig oder unwillig, bewußt oder unbewußt soll ich mich anpassen und einfügen - es sei denn, ich wolle mich selber zum verachteten, befehdeten oder belächelten Außenseiter stempeln.
.
Zwei Arten von Manipulationen - gutgemeinte und böswillige
Ein Amerikaner, Walter G. Pinecoke, hat einmal behauptet: »Wann immer ein Mensch den Mund aufmacht, um mit einem anderen zu reden, hat er im Grunde genommen nur eines im Sinn: Er will ihn manipulieren und den größten Nutzen daraus ziehen.«
Man wird gegen die erwähnten Beispiele einwenden, dies alles seien meist gutgemeinte Manipulationen. Es gäbe demnach gutgemeinte und böswillige. Hier wird der zwielichtige Charakter des Begriffs sichtbar.
Ich würde diese Unterscheidung nicht unbedingt von der Hand weisen. Nur stellt sie uns vor die heikle Frage: Können wir denn in jedem Falle und gültig beurteilen und entscheiden, was gut gemeint und was böswillig ist? Hält nicht oft der eine für gut und richtig, was dem andern als falsch und böse erscheint? Manipulation ist offenbar auch ein moralischer Begriff und ein moralisches Problem.
Merkwürdigerweise wird, wenn von Manipulation im Fernsehen die Rede ist, auf jeden Fall immer etwas Ungutes, etwas Böswilliges, etwas Falsches gemeint. Im Zusammenhang mit dem Fernsehen mobilisiert der Begriff bei uns spontan Gefühle der Empörung, der Ablehnung, des Mißtrauens, der Angst.
Wir sollen durch Manipulation zu einer bestimmten Meinung, zu einem bestimmten Verhalten verführt, verleitet, gedrängt werden. Wir sollen getäuscht, hintergangen, übertölpelt werden. Darauf reagieren wir allergisch und rufen erbost: »Manipulation!«
.
Objektivität gegen Manipulation?
.
Objektivität - die Garantin der Wahrheit ?
Unsere Gegenforderung an das Medium lautet: »Objektivität«. In der Objektivität glauben wir das Schutzmittel gegen die Manipulation gefunden zu haben. Manipulation arbeitet mit Täuschung und Lüge, meinen wir, und Objektivität ist die Garantin der Wahrheit.
Treiben wir da aber nicht den Teufel mit Beelzebub aus? Ist Objektivität nicht ein mindestens so zwielichtiger und relativer Begriff wie Manipulation?
Im Gegensatz zu Manipulation ist Objektivität ein wissenschaftlicher Begriff. In der Wissenschaft wird vom Forscher Objektivität der Aussage gefordert. Das heißt: eine wissenschaftliche Aussage über irgendeinen Gegenstand muß unabhängig vom einzelnen Forscher auf Grund bestimmter Prüfungs- und Kontrollregeln von anderen Forschern als gültig befunden werden können.
Eine wissenschaftliche Aussage wird diesen Objektivitätstest nur bestehen, wenn sie von höchster begrifflicher Präzision, von absoluter Lückenlosigkeit, von vollkommener Sachlichkeit, durch eindeutige Beweise abgesichert ist und Werturteile, soweit als möglich, vermeidet.
Läßt sich dieser Wissenschaftsbegriff Objektivität so ohne weiteres, fugenlos und ohne Einschränkungen auf das Gebiet der Publizistik übertragen? (Und unter Publizistik verstehe ich ausnahmslos alle Arten von Sendungen im Fernsehen.) Ganz gewiß nicht.
Wer es tut, überfordert nicht nur den Beruf des Journalisten und das Medium Fernsehen, er wird auch stets in einem falschen, verkorksten Verhältnis zu diesem Medium stehen und immer in Zank und Hader mit ihm leben. Es ist ebenso unsinnig wie gefährlich, als einzige Alternative zur Manipulation die totale Objektivität zu fordern.
.
Fernsehen wird von Menschen gemacht
.... der Apparat Fernsehen wird von Menschen bedient und gesteuert. Und Menschen sind keine Objektivitätsroboter. Schon gar nicht an Stellen, an denen es um Informationen und Meinungen geht. Selbst der Journalist, der nach größtmöglicher Sachlichkeit strebt - und jeder ehrenwerte Journalist wird dies immer wieder tun -, wird die 100 Prozent nur mit gut Glück zu 80 oder 90 Prozent erreichen. Und mit den restlichen Prozenten wird es immer Ärger geben.
Immer wieder werden wir in Berichten und Kommentaren, in Dokumentarfilmen und Unterhaltungssendungen irgend etwas finden, was wir für falsch erachten, was unserer Meinung widerspricht, was uns zumindest nicht gefällt. Und wenn einer gar eine empfindliche Politikerseele ist, wird er täglich, ja stündlich einen Anlaß finden, sich über irgendeine »Manipulation« zu empören.
Seltsamerweise hat sich übrigens der Begriff Manipulation gerade bei Politikern mit sogenannten oder scheinbaren »links-progressiven« Sendungen verbunden. Manipulation ist für sie immer etwas, das von »links« kommt.
Als ob nicht die ungeheuerlichste Manipulation dieses Jahrhunderts, die totale Manipulation ganzer Völker durch Faschismus und Nationalsozialismus, von sehr rechts gekommen wäre! Diese absolut undifferenzierte, einseitige Handhabung und Linksverdrehung des Begriffs ist an sich schon wieder eine unstatthafte Manipulation.
Im übrigen sind diese Manipulationsrufe von politischer Seite auch nicht immer ganz unverdächtig. Sie ertönen vor allem von Leuten, die ihrerseits meinen, im Besitze der alleinseligmachenden, unmanipulierten, objektiven Information zu sein - wobei sie im Grunde nichts anderes wollen, als selber die Massen nach ihrer Meinung manipulieren.
Sie fordern eine strenge Kontrolle und Überwachung des Mediums und behaupten, dadurch würde die Objektivität der Information gewährleistet. In Tat und Wahrheit wird dadurch höchstens eine Manipulation durch eine andere ersetzt.
.
Gibt es eine "Totale Objektivität" ?
Die "Totale Objektivität" wäre gleichbedeutend mit totaler Information: eine Information, die dem Zuschauer ein Ereignis in seiner Vollständigkeit, in seinem tatsächlichen Ablauf mit allen detaillierten Fakten zu präsentieren versuchte; eine Information, die über schlechthin alles berichten würde, was sich täglich über den ganzen Erdball hin abspielt.
Selbst bei bestem Willen wäre eine solche totale Information nicht zu erzielen. Darum ist auch eine Formulierung wie jene im Konzessionsartikel 13 der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) derart problematisch. Dort heißt es, Radio und Fernsehen hätten eine »objektive, umfassende und rasche Information zu vermitteln«.
»Raschheit« - dies mag noch als die einfachste Forderung erscheinen, obwohl bereits sie ihre Tücken in sich birgt. Wer täglich Hunderte von Nachrichten empfängt und sie unter Tempostreß prüfen, auswählen und redigieren muß, tut leicht einmal einen Fehlgriff. Zeit zum Nachdenken bleibt da oft nicht viel.
.
Ein paar Beispiele für Fehlgriffe (aus dem Jahr 1979)
Und so kann es schnell passieren, daß einmal das Unwichtigere dem Wichtigeren vorgezogen wird, daß fragwürdige sprachliche Formulierungen stehenbleiben oder unbedacht hineinrutschen.
Hier aber kann sublime Manipulation bereits beginnen, wenn zum Beispiel vom »israelischen Verteidigungsminister« und vom »ägyptischen Kriegsminister« gesprochen wird oder wenn »arabische Terroristen« zu »palästinensischen Freiheitskämpfern« umgemodelt werden. Solche scheinbaren Kleinigkeiten mögen noch aus Unachtsamkeit durchschlüpfen, obwohl es eigentlich zur beruflichen Begabung und Eignung des Tages- Journalisten gehören würde, daß ihm selbst unter größtem Zeitdruck eine solch manipulierte Wortwahl auffallen würde.
Nichts mehr mit Zeitdruck und flüchtiger Redigierung hat es allerdings zu tun, wenn zum Beispiel gemeldet wird, eine Umfrage habe ergeben, daß sich eine relative Mehrheit der Schweizer für die Fristenlösung bei der Abtreibung ausgesprochen habe.
Es waren 33 Prozent. Die restliche große Mehrheit hatte eine der Indikationslösungen bevorzugt. Der Trick der Redaktion bestand darin, daß man die Anhänger der verschiedenen Indikationslösungen willkürlich voneinander trennte, um so die größte Befürworterzahl für die Fristenlösung zu bekommen.
Man mag zum Abtreibungsproblem stehen wie man will, aber im Umgang mit dieser Information war eindeutig handfeste Manipulation mit im Spiel. Der Forderung nach Informationsraschheit kann man jedenfalls eine derartige Faktenverzerrung nicht in die Schuhe schieben.
.
Mit der Manipulation leben
.
Die Vorschrift lautet : »Objektiv und umfassend«
»Objektiv und umfassend« lautet des weiteren die Konzessionsvorschrift. Schön und gut. Aber hat man dabei bedacht, vor welchem Auswahlproblem jeder Nachrichtenredaktor steht? Von Agenturen und Korrespondenten und über den internationalen Fernsehaustausch gehen beispielsweise bei der Tagesschau täglich um die 1.200 Einzelmeldungen ein.
Nur ein Bruchteil davon kann in den Informationssendungen erscheinen. Dabei haben die Redaktoren weder Zeit noch Möglichkeit, jede Meldung auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.
Selbst ein kenntnisreicher, routinierter und erfahrener Nachrichtenmann weiß oft nicht, durch wie viele Köpfe und Hände eine Meldung bereits gegangen ist, ob sie frei von Verzerrungen oder gar Unwahrheiten ist. Dann muß er selber die Meldung noch für den Nachrichtensprecher umschreiben, kürzen, redigieren.
Nicht jeder bringt dabei die Fairneß auf, von seiner eigenen politischen Denkart ganz zu abstrahieren. So spielen bei der Auswahl und Redigierung der Nachrichten oft ungewollt und unmerklich subjektive Ansichten des Redaktors mit.
Dazu tritt beim Fernsehen die Versuchung, jenen Nachrichten den Vorrang zu geben, zu denen man interessantes Bildmaterial bekommen hat, während Nachrichten, die kein Bild hergeben, eher vernachlässigt werden, obwohl sie vielleicht wichtiger und wesentlicher sind als die "nichtillustrationsfähige" Information. Es liegt im Wesen des Fernsehens, daß es das Schaubare und Zeigbare überbewertet.
.
»Willkürliche Nachrichtenauswahl« - wirklich ?
»Willkürliche Nachrichtenauswahl« lautet ein Manipulationsvorwurf gegen die Tagesschau (das gabs schon im Jahr 1979). Als ob eine andere als willkürliche Auswahl möglich wäre! Die tägliche, ja stündliche Nachrichtenflut ist heute derart groß, daß sie das Fernsehen nur durch Auswahl zu bewältigen vermag.
Jeder, der eine solche Auswahl zu treffen hat, wird sie anders treffen, weil jeder den Wert einer Nachricht anders gewichtet. Als willkürlich bezeichnet dann jeder die Auswahl des andern, weil sie nicht der seinen entspricht.
Ein Massenmedium kann diesen je und je subjektiven Ansprüchen, Wertungen und Erwartungen jedes einzelnen kaum gerecht werden. Wer dies vom Fernsehen fordert, überfordert es maßlos.
Sicher wird man verlangen müssen, daß so viel und so verschiedenes Informationsmaterial als möglich gebracht und daß bei der Auswahl der Nachrichten an die Interessen der verschiedensten Bevölkerungskreise gedacht wird. Die Chance, daß dadurch das Wesentliche auch erfaßt wird, ist dann um so größer.
Aber selbst beim besten Willen der Redaktoren - und dieser gute Wille muß unbedingt vorausgesetzt werden können - werden Entscheidungen darüber, welche Information sendewürdig ist, bis zu einem gewissen Grad immer subjektiv bleiben. Übrigens wird auch auf der Empfängerseite jeder einzelne Zuschauer die Informationen in bezug auf ihre Wesentlichkeit immer anders beurteilen als der einzelne Redaktor.
Die Manipulation des Nachrichtenmaterials fängt nicht erst auf (in) der Fernsehredaktion an. Der Fernsehredaktor arbeitet am Ende einer langen Kette von Abhängigkeiten. Jede Nachricht hat schon von ihrem Ursprung her tendenziell eine Richtung.
Die erste Ausrichtung kommt vom Informanten; das können Regierungen, Behörden, Verwaltungen, Unternehmen, Institutionen usw. sein, die ihre Interessen wahrnehmen wollen. Solche offiziellen Communiques, Verlautbarungen und Stellungnahmen sind insofern bereits häufig manipuliert, als sie oft das Entscheidende verschweigen oder sogar einen Mißerfolg zu bemänteln versuchen.
Der Reporter oder Journalist wird darum zusätzliche Recherchen anstellen, aber auch er wird bei seiner Berichterstattung persönliche Ansichten nicht ganz ausschalten können.
.
Jede Nachricht durchläuft verschiedene Filter.
Auf dem langen Informationshindernislauf bleibt manche Meldung auf der Strecke, wird irgendwo unterdrückt oder erfährt Abstriche und Zusätze. Wer garantiert dem zuletzt Auswählenden, zum Beispiel dem Redaktor der Tagesschau, die absolute Objektivität und Zuverlässigkeit der Nachricht? Kann er sie in jedem Falle kontrollieren und nachprüfen?
Nachrichten führen keine unabhängige Existenz. Sie sind das Produkt einer Nachrichten sammelnden, verwertenden und vor allem verkaufenden Informationsindustrie, hinter der oft starke lenkende Mächte stehen, wirtschaftliche oder politische oder ideologische Kräfte.
- Anmerkung : Gerade im Januar 2025 sehen wir das nach der US-amerikanischen Präsidentenwahl, wie Nachrichten manipuliert und verdreht werden - und das ganz offziell von ganz oben.
Nachrichten sind zu einer Ware geworden, die nach den Regeln von Angebot und Nachfrage verkauft wird. Es ist eine zunehmende Verkommerzialisierung des Nachrichtenhandels festzustellen. Und da sensationelle Nachrichten aller Art leichter verkäuflich sind, werden sie besonders häufig auf den Markt geworfen. Sensationelle Nachrichten sind aber nicht immer auch wichtige und relevante Nachrichten.
Kommt dazu, daß in vielen Staaten der Nachrichtenaustausch nicht frei ist, sondern unter strenger Zensur steht. Aus vielen Ländern der Welt vernehmen wir daher die Wahrheit nicht, und Nachrichten, die von dort zu uns gelangen, sind nach Willen und Absicht der herrschenden Mächte zurechtgebogen.
Der ganze Nachrichtenmarkt ist von seinen Ursprüngen her bereits mehr oder weniger manipuliert. Wer kann unter diesen Umständen noch an eine »objektive und umfassende« Information glauben?
.
Wo informiert wird, wird immer auch manipuliert.
Halten wir fest: Wo informiert wird, wird immer auch manipuliert.
Manipulation braucht aber nicht immer aus böswilliger, arglistiger Absicht zu erfolgen; sie liegt oft in der Sache und in den Verhältnissen an sich. Es gibt, sozusagen, eine normale, sachliche, unbeabsichtigte Manipulation, die kaum, jedenfalls nie ganz auszuschalten ist. Mit ihr müssen wir leben lernen.
Und es gibt eine unsachliche, absichtliche Manipulation, die ins Böswillige, Perfide, Verwerfliche übergehen kann. Die eine ist von der andern oft nicht leicht zu unterscheiden.
Was die Schwierigkeiten mit der »objektiven und umfassenden« Information auf dem Gebiete des Nachrichtenangebots und der Nachrichtenauswahl betrifft, so hat das Fernsehen diese Problematik weitgehend mit dem Radio und mit der Presse gemein. Dazu treten nun aber noch einige fernsehspezifische Probleme.
.
Verfälschte Wirklichkeit
.
Die Nachrichten von einem sichtbaren Sprecher
Eine subtile Art von Manipulation im Fernsehen entsteht zum Beispiel allein schon dadurch, daß die Nachrichten von einem sichtbaren Sprecher verlesen werden. Man nimmt dazu möglichst gut aussehende, etwas unterkühlte Typen, die nichts als reine, unpersönliche Sachlichkeit und männliches Vertrauen ausstrahlen.
Sie verlesen alle Nachrichten im gleichen stereotypen, unbeteiligten Tonfall und schauen von Zeit zu Zeit mit sanftem und besänftigendem Blick vom Manuskript auf. Ob sie von den jüngsten Morden in Irland berichten oder von einer Kaninchenausstellung, von Geiselmorden in Tunis oder von der neuesten Römer Modenschau - es tönt alles genau gleich wichtig.
Der Nachrichtensprecher - seine Kleidung (seine Krawatte), seine Gesten, sein Gesicht - wird optisch konsumiert; das Bild überlagert die Worte, es steht der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Wort im Wege. Wir sollten aber nicht nur hören und glauben, was uns im Fernsehen mitgeteilt wird, wir sollten es auch begreifen.
Vom Bild geht aber eine derart starke emotionelle Wirkung aus, daß eine intellektuelle Bewältigung des Gehörten und Gesehenen kaum mehr stattfindet. Und trotzdem gilt einem noch immer weitverbreiteten Volks(aber)glauben das Fernsehen als das »wahrste«, »glaubwürdigste«, »objektivste« Informationsmedium.
.
Man meint, das Fernsehen vermittle ein wirkliches Bild der Wirklichkeit, weil man nicht einfach glauben müsse, was man im Radio gehört oder in der Zeitung gelesen habe. Durch das Fernsehen werde man unmittelbarer Augenzeuge der Ereignisse. Das Objektiv der Kamera bürge für die Objektivität der Bilder und damit für die Objektivität der Information. Dies ist eine arge Täuschung.
.
Den Ausschnitt der Wirklichkeit einfangen ?
Von der Live-Aufnahme gilt dies nicht weniger als vom Film. Man "würde" zwar zunächst "meinen", die Direktübertragung mit elektronischen Mitteln sei kaum zu Manipulationen geeignet. Aber das ist ein Irrtum. Die Manipulation beginnt schon damit, wie der Regisseur die Kameras aufstellen läßt. Davon hängt es ab, welchen Ausschnitt der Wirklichkeit er einfangen kann.
Und Ausschnitt ist immer alles, was wir sehen. Sodann kann der Regisseur die Kameras auf ganz verschiedene Weise lenken. Nehmen wir die Olympischen Spiele zum Beispiel. Ich bekomme von diesem Anlaß einen anderen Eindruck, wenn mir der Regisseur immer nur strahlende, glückliche Sieger zeigt oder wenn er seine Kameras vor allem auf die Verlierer, auf die Geschlagenen, auf die Verletzten und Ausgepumpten lenkt. Auf die eine Weise wird mir die Olympiade zu einem Hochfest der Körperheroen, auf die andere Weise zu einem gräßlichen Schlachtfeld stumpfsinnigen Spitzensports.
Auch bei der Live-Übertragung findet Auswahl aus der Wirklichkeit statt, also Manipulation, Lenkung des Zuschauers nach bestimmten Absichten. Dazu kommt, daß Journalisten und Regisseure ohne böswillige Absicht - einfach, weil es beim Publikum gut ankommt - gerne der Sucht verfallen, jenen Ereignissen den Vorrang zu geben, die »schöne«, »gute« oder sensationelle Bilder liefern. Auch hier kann die normale, sachliche Manipulation leicht in eine unsachliche, verwerfliche übergehen. Manipulation ist es alleweil.
.
Achtung : "Aufpassen, das Fernsehen ist da" .....
Damit aber nicht genug. Oft geschieht es auch, daß sich allein durch die Anwesenheit des Fernsehens die Wirklichkeit verändert. Dieser Manipulation unterliegt zum Beispiel die Presse weniger. Wenn aber eine Fernseh-"Equipe" (gemeint ist ein größeres Fernsehteam) mit ihrem großen Übertragungsapparat anrückt, ändern die Leute oft ihr Verhalten.
Sie geben sich nicht mehr »normal« und reden anders als gewöhnlich vor der Kamera. (Man kennt die Gefahren einer Fernsehübertragung von Parlamentsdebatten. Die Politiker reden nicht mehr so sehr zur Sache als vielmehr, wie man sagt, »zum Fenster hinaus«.)
Eine politische Demonstration beispielsweise kann durch die Anwesenheit eines Fernsehteams ungeahnte Ausmaße annehmen. Schon oft haben kleine Demonstrationen, weil sie vor dem Fernsehen stattfanden, eine Wendung ins Spektakuläre und Gewalttätige genommen, eine Wendung, die sich ohne die Präsenz des Fernsehens nie ereignet hätte.
Nicht nur das Fernsehen kann also die Wirklichkeit verfälschen; vor dem Fernsehen verfälscht sich die Wirklichkeit gelegentlich selbst.
.
Fußball, Spaghettibäume und Venedig
.
Die Bildgläubigkeit des heutigen Menschen
Die Unzuverlässigkeit der Live-Kamera läßt sich an einem Sport-Beispiel demonstrieren. Wer ein Fußballspiel zu Hause am Bildschirm mitverfolgt, glaubt, die beste Zuschauerposition innezuhaben. Millionen von Zuschauern meinen darum, Regel Widrigkeiten wie Abseitsstellungen usw. besser zu sehen und zu erkennen als selbst der Schiedsrichter. Sie meinen, die Kamera sei unbestechlich und unfehlbar und das Bild habe dokumentarische Beweiskraft.
Dabei vergißt der Zuschauer, daß die Kamera, die im Stadion meistens in der Verlängerung der Mittellinie auf der Haupttribüne aufgebaut ist, gegenüber zwei menschlichen Augen einen entscheidenden Nachteil hat: sie kann nämlich nicht perspektivisch sehen, kann also die Spielszenen nicht räumlich erfassen.
Dadurch ergeben sich perspektivische Verzeichnungen und Verzerrungen, denen der Schiedsrichter und die Linienrichter unten auf dem Spielfeld nicht ausgesetzt sind. Aber der getäuschte Zuschauer glaubt es besser zu wissen und ergießt zwischen Bier und Erdnüßchen eine Suada von Schimpfwörtern über den armen Schiedsrichter, der scheinbar eine Fehlentscheidung getroffen hat. Der Zuschauer vertraut blindlings auf die Objektivität des Bildes und ahnt nicht, welcher Manipulation durch die Kamera er aufgesessen ist.
Die Bildgläubigkeit des heutigen Menschen ist enorm, ja erschreckend. Da hat einmal ein witziger Kameramann zum 1. April ein Filmchen gedreht, in dem er blühende Spaghettibäume im Tessin zeigte (er hatte in mühevoller Arbeit zahllose Spaghetti mit Klebestreifen an Lorbeerbäumen befestigt). Es war zu sehen, wie die Spaghetti gepflückt und zum Trocknen an der Sonne ausgebreitet werden.
Als die BBC diesen Film ausstrahlte, standen die Telefone nicht mehr still. Während Stunden hagelte es Anfragen: ob das wirklich wahr sei? Es kam zu Familienstreitigkeiten. Die Frau behauptete, Spaghetti würden doch aus Mehl und Wasser gemacht. Aber der Mann beharrte darauf: Spaghetti wachsen auf den Bäumen, das habe man jetzt doch »mit eigenen Augen« gesehen. Tausende glaubten an die Spaghettibäume.
.
Über die Illusion der eigenen Augenzeugenschaft
Das Fernsehbild versetzt uns in die Illusion der eigenen Augenzeugenschaft. Durch das bewegte Bild läßt sich der Zuschauer geradezu hypnotisieren, er glaubt »dabeizusein«.
Die Bereitschaft des Fernsehzuschauers zur Selbsttäuschung ist beinahe grenzenlos. Und in dieser Bereitschaft liegen die Wurzeln und die Gefahren der Manipulation. Es gilt, die Scheinobjektivität des Bildes zu durchschauen.
Dies gilt vom Film noch mehr als von der Live-Übertragung. Auch der größte Teil aller Filmdokumente ist nicht, wie wir so gerne glauben, »aus dem Leben gegriffen«.
Auch beim Film fängt die Manipulation schon mit dem Kamerastandpunkt an. Der Kameramann nimmt die Bilder der Wirklichkeit von einem bestimmten Standort aus in einer bestimmten Perspektive auf, die von seinem persönlichen Standpunkt abhängig sind.
- Anmerkung : Stimmt nicht ganz, der Regisseur beschreibt dem Kameramann, wie er die Szene gerne hätte.
Was sich links und rechts der aufgenommenen Bilder abspielt, sehen wir nicht. Wir sehen nur subjektiv gewählte Ausschnitte aus der ganzen Wirklichkeit.
Für ein gutes Filmdokument braucht es überdies gutes Licht und einen guten Ton. Dies alles findet sich in der unmittelbaren Wirklichkeit oft nicht hinreichend vor. Es muß vom Kameramann oder vom Regisseur arrangiert werden. Es ist gestellt. Es ist manipuliert.
.
Die suggestive Wirkung von Filmaufnahmen
Die Wirkung von Filmaufnahmen ist auch abhängig von der unterschiedlichen Verwendung der verschiedenen Kameraeinstellungen. Man kann von einem Detail eine Großaufnahme machen. Dadurch können einzelne Fakten ganz intensiv, ja suggestiv hervorgehoben werden. Gleichzeitig reißt die Großaufnahme durch ihren kleinen Ausschnitt das Detail aus den Zusammenhängen heraus. Mit der Großaufnahme können Zusammenhänge vertuscht und verschwiegen werden.
Demgegenüber können mit der Totale zwar Zusammenhänge gezeigt werden, aber auf Kosten der Einzelheiten. Die Totale wirkt undifferenziert. Mit der Totalen kann man unangenehme Einzelheiten auf Distanz halten oder im großen Zusammenhang untergehen lassen.
Man kann durch geschickt ausgewählte Großaufnahmen und raffinierte Totalansichten einen Film über Venedig drehen, der ein märchenhaft schönes, unzerstörtes Bild der Lagunenstadt vermittelt; da wäre nichts zu sehen von Zerfall und Untergang.
Und man kann über Venedig einen Film drehen, der in Einzelheiten und Gesamtansichten das Bild einer total zerbröckelnden Stadt zeigt, die schon morgen zusammenbrechen und in den schmutzigen Fluten versinken wird. Lockende Touristenwerbung der eine Film, alarmierender Notruf der andere.
Des weiteren muß man sich stets bewußt sein, daß fünf- bis zehnmal mehr Filmmaterial belichtet wird, als nachher im endgültigen Film verwendet wird. Beim Film-Schnitt wird eine Auswahl aus dem gesamten Bildmaterial getroffen, und die Auswahl geschieht nach bestimmten Gesichtspunkten, nach bestimmten Ansichten und Absichten des Autors, des Realisators und der Cutterin. Hier taucht die Frage auf:
Wie lange wird ein Faktum im Verhältnis zu anderen Fakten gezeigt? Wie verhalten sich die im Film gezeigten Proportionen zu den Proportionen in der Wirklichkeit? In der Schnittmontage bekommen die einzelnen Phänomene je nach Länge oder Kürze ihrer Darstellung eine verschieden starke Gewichtung.
Manipulation durch Proportionsverzerrung ist eines der heikelsten, weil nur schwer durchschaubaren Probleme. Negative Fakten können zum Beispiel durch die Ausführlichkeit ihrer Darstellung überdimensional aufgeblasen, positive Fakten durch kurzgeschnittene Sequenzen ins Unbedeutende hinuntergespielt werden. Und umgekehrt.
.
Die Faszinationskraft des Bildes
.
Töne verändern die Bildaussage entscheidend
Den montierten Filmteilen werden Töne, Geräusche, Musik beigefügt, die die Bildaussage oft fast unmerklich, aber entscheidend verändern. Es gibt darüber instruktive Experimentalfilme.
Einer zeigt zum Beispiel einen Mann, der ein Treppenhaus hinaufgeht. Zuerst ohne Ton: man hat den Eindruck, da geht ein Mann die Treppe hinauf. Dann das gleiche Bild zusammen mit einer beschwingten Musik: sie weckt in uns die Empfindung, den Mann erwarte oben irgend etwas Freudiges, vielleicht eine hübsche Frau. Und dann das gleiche Bild mit einer düsterdrohenden Musik: ein Mörder nähert sich seinem Opfer im vierten Stock.
Schließlich werden die Bilder mit Kommentaren versehen, welche die Interpretation des Bildes aus der Perspektive des Redaktors, Journalisten oder Reporters ebenfalls in eine bestimmte Richtung lenken.
In einem Dokumentarfilm über Bolivien heißt es im Kommentar zum Beispiel: »Jedes zweite Kind stirbt im ersten Lebensjahr an Unterernährung.« Das ist ein wahres, schockierendes Faktum. Die Aussage wird aber abgeschwächt durch das Bild.
Im Bild ist ein Jeep zu sehen, vom Jeep aus wird einem Kind ein Stück Brot gereicht. Die Aussage des Kommentars wird also aufgefangen durch die Aktion des Bildes, on welchem geholfen wird. Der Film zeigt an dieser Stelle und auch sonst nirgendwo ein hungerndes oder gar verhungertes Kind. Eine erschreckende Tatsache, die der Film im Kommentar zwar nennt, wird durch ein neutralisierendes Bild so verharmlost, daß sie keinem Zuschauer mehr weh tut. Das kann bewußte oder unbewußte Manipulation sein.
.
Wenn Zuschauer eine Sendung kommentieren
Wie denn überhaupt das Bild eine derart starke Faszinationskraft ausübt, daß der Zuschauer den Kommentar dazu sehr oft völlig überhört. Es ist manchmal erschütternd, aus kritischen Zuschauerbriefen immer wieder erfahren zu müssen, wie ungenau der Kommentar zu einem Film aufgenommen worden ist.
Die Zuschauer behaupten oft die hanebüchensten Dinge, die gesagt worden sein sollen. Oft hören sie im Zwiespalt zwischen Bild und Wort das pure Gegenteil dessen heraus, was wirklich gesagt worden ist.
So findet im Laufe der Filmarbeit mindestens eine doppelte, ja meist drei- und vier-, manchmal sogar vielfache Manipulation statt.
Das Bild ist ein leicht verformbarer Rohstoff und hat einen nur recht unscharfen Informationsgehalt. Es erregt weniger unser Denken als unsere Emotionen. Wir interpretieren es gefühlsmäßig.
Ein bekanntes frühes Experiment von Kuleschow aus 1923
Dazu gibt es ein bekanntes frühes Experiment des russischen Filmregisseurs Kuleschow. Im Jahr 1923 hat er drei Kopien der genau gleichen Großaufnahme eines russischen Schauspielers mit drei anderen Aufnahmen verkoppelt: eine Kopie mit der Aufnahme eines vollen Tellers Suppe, eine andere mit der Aufnahme einer betörend verführerischen Frau und schließlich die dritte mit der Aufnahme eines Toten.
Zuschauer, denen er diese drei Montagen vorführen ließ, glaubten in dem absichtlich ausdruckslosen Blick des Schauspielers plötzlich etwas zu erkennen, was vorher nicht vorhanden gewesen war: im ersten Fall den Ausdruck des Hungers, im zweiten den der Lüsternheit und im dritten den Ausdruck von Furcht und Schrecken.
Dreimal hatte das gleiche, unveränderte Bild des Schauspielers seine Bedeutung gewechselt, dreimal hatte es auf die Zuschauer verschieden gewirkt. Diese experimentelle Filmmontage von Kuleschow war vielleicht das erste Beispiel einer gelungenen totalen »Manipulation«.
.
Material zur eigenen Meinungsbildung
.
neutral, ideologisch wertfrei = »objektiv« ?
Es ist eine naive Illusion zu glauben, es gäbe eine manipulationsfreie Filmdokumentation. Der Filmemacher mag noch so sehr der Überzeugung sein, er verhalte sich bei den Dreharbeiten neutral, ideologisch wertfrei, »objektiv«.
Immer werden subjektive und gesellschaftlich bedingte Normen und Wertvorstellungen in sein Verhalten einfließen - und damit geschieht unvermeidlich immer Manipulation. Die Frage ist nicht, ob manipuliert wird oder nicht - sondern: Wer manipuliert nach welchen Wertmaßstäben? Welchen ideologischen Standpunkt nimmt der Filmmacher ein? Ist ihm dieser Standpunkt bewußt, und setzt er darüber den Zuschauer ins Bild?
Gefährlich wird Manipulation dann, wenn der Manipulierende den Zuschauer nicht über seinen eigenen Standpunkt aufklärt und statt dessen seine subjektive Sichtweise unter dem Deckmantel der Objektivität als sachlich neutral und wertfrei, als »objektiv« verkauft.
Hier wird Manipulation zur bewußten und versteckten Steuerung des Zuschauers, der ohne sein Wissen als Objekt behandelt wird. Hier geschieht Freiheitsberaubung, hier wird die Selbstbestimmung des Individuums verhindert, hier geschieht Vergewaltigung. Und diese Art von Manipulation kann nicht entschieden genug abgelehnt und bekämpft werden.
.
Manipulation ist ein verschwommener und schillernder Begriff.
Einerseits findet irgendeine Art von Manipulation immer statt - es gibt unvermeidbare Manipulationen, die in der Sache oder im Medium selber begründet sind und die nicht unbedingt des Teufels sein müssen - und anderseits gibt es unsachliche, gewissenlose, böswillige Manipulationen, die dann und dort stattfinden, wenn über ein Ereignis, ein Problem, einen Sachverhalt absichtlich falsch informiert wird, um dem Zuschauer eine bestimmte Meinung einzuimpfen, indem man ein Problem, ohne daß der Zuschauer es merken soll, mit raffinierten Mitteln verzerrt darstellt, weil man den Zuschauer einseitig beeinflussen und für eine falsche Ansicht gewinnen will; das ist jene Manipulation, die unsere Trägheit, unser Unwissen, unsere Bequemlichkeit und unsere Unsicherheit ausnützt.
(Manchmal ist solche Manipulation aber nicht einmal böswillig beabsichtigt, sondern ereignet sich einfach darum, weil ein Reporter für ein Problem, über das er zu berichten hat, gar nicht zuständig ist; aus bloßer Unfähigkeit also.)
An sich aber ist Manipulation ein unvermeidbares Übel, das in Kauf genommen - das aber gleichzeitig durchschaut werden muß. Sich vor dem Manipuliertwerden schützen kann aber nur derjenige, der erkennt und weiß, wo und wie Manipulation geschieht.
Damit ihm dies möglich ist, darf er den Medienangeboten nicht passiv und unkritisch gegenüberstehen, sondern muß gewußt und gezielt auswählen, kritisch prüfen, darüber nachdenken, mit anderen Leuten darüber sprechen und dazu Stellung beziehen.
.
Die Manipulation durchschauen lernen
Um Manipulation durchschauen zu lernen, ist frühe Medienerziehung in der Schule ein dringendes Postulat. Und zwar ist es nicht damit getan, daß der Lehrer mit den Schülern mal ein Stündchen oder zwei über das Fernsehen plaudert.
Der Schüler muß mit der Film- und der elektronischen Kamera umgehen lernen. Die Schüler sollen selber gemeinsam Sendungen gestalten und Filme drehen. Wer selber einmal einen Film gedreht, geschnitten, kommentiert und vertont hat, weiß Bescheid darüber, wie's gemacht wird, und läßt sich nie mehr durch Fernsehsendungen täuschen. Er kennt die Eigenarten und Tücken des Mediums aus direktem Erleben und wird dem Medium immer mit skeptischer und kritischer Distanz gegenüberstehen.
Der Zuschauer muß sich ständig im klaren darüber sein, daß das Fernsehen nicht das einzige und sicherste Medium für eine möglichst gründliche und umfassende Information ist. Wer wirklich einigermaßen ganz und richtig informiert sein will, muß auch verschiedene Zeitungen lesen, muß Radio hören (nicht nur die eigenen inländischen Sender), muß Bücher lesen, wenn es darum geht, sich über ein Thema vertiefte Kenntnisse anzueignen, muß Vorträge von ausgewiesenen Fachleuten besuchen, muß an Diskussionen teilnehmen, muß das klärende Gespräch im Familien- und Freundeskreis pflegen.
- Anmerkung im Januar 2025 : Ganz erstaunlich - hier beschreibt der Autor Dr. Eduard Stäuble im Jahr 1979 die Grundgedanken unserer Museenseiten, ohne daß wir uns jemals kennengelernt oder getroffen hatten. Der nachfolgend Absatz entspricht absolut unseren Gedankengängen und Zielen.
.
- Wer im Besitze verschiedenster Informationen ist, kann vergleichen, entdeckt Widersprüchliches, Unklarheiten, findet Übereinstimmendes und erhält so letzten Endes ein wenigstens einigermaßen zuverlässiges Bild vom wahren Sachverhalt. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Quantität der Informationen an als vielmehr auf deren Qualität, vor allem aber darauf, ob und wie einer das Informationsmaterial denkend verarbeitet.
.
Es geht um das Material zur eigenen Meinungsbildung
Das Phänomen der Manipulation ist ein Phänomen der Vermittlung.
Die Frage lautet: Wie teile ich etwas möglichst sachlich und zuverlässig mit, und wieviel Freiheit lasse ich dem andern, an meiner Darstellung zu zweifeln und Fragen zu stellen? Es geht nicht um ein falsches Streben nach totaler Objektivität. Sie bleibt selbst dem seriösesten Journalisten unerreichbar.
Es geht für den Fernsehschaffenden vielmehr darum, den Zuschauer ausreichend mit Material zur eigenen Meinungsbildung zu versorgen. Dies gilt für einen Fernsehschaffenden dort um so unbedingter, wo er bei einem Monopolinstitut arbeitet.
Was wir brauchen, sind Fernsehschaffende, die eine unsachliche, verzerrende Manipulation verabscheuen, die sich des unvermeidlich Manipulativen in ihrem Schaffen bewußt sind und seine gefährlichen Folgen und Wirkungen durch eine möglichst sachgetreue Information auf ein erträgliches Minimum zu reduzieren trachten.
Nur der gut ausgebildete, verantwortungsbewußte Journalist ist eine Garantie dafür, daß auch noch die manipulierte Information eine einigermaßen wahre Information bleibt, daß auch die manipulierte Information immer noch einen hohen Grad an Wirklichkeit wiedergibt.
Nur dieser Journalist läßt sich auch selber nicht manipulieren - weder von seinem eigenen Egoismus, das heißt: von einem bloßen Hang nach rücksichtsloser Selbstverwirklichung, noch durch irgendwelche Interessengruppen, die auf ihn einzuwirken und ihn für ihre Zwecke auszunutzen suchen. Nur ein solcher Journalist wird glaubwürdig sein und Glaubwürdigkeit verdienen.
Möglichst wahrheitsgetreue Information ist kein Problem der Gesetzgebung, kein Problem der Kontrollen, kein Problem der Überwachung (wie gewisse medienfremde Politiker immer noch zu meinen scheinen). Sie ist vielmehr ein Problem dessen, der mit wachem Geist, mit wachem Verantwortungsbewußtsein, mit unbestechlichem Mut und durchdrungen von einem hohen Berufsethos Informationen sammelt, auswählt, prüft, verarbeitet und an die Zuschauer weitergibt.
.
Die Selbstmanipulation des Zuschauers
.
Auch der Fernsehzuschauer ist gefordert
Aber nicht nur vom Fernsehjournalisten, sondern auch vom Fernsehzuschauer muß die Bereitschaft zu einem Minimum an Objektivität verlangt und erwartet werden. Daran fehlt es leider noch oft. Der Zuschauer ist oft ein geheimer Manipulator seiner selbst.
Es ist bekannt, daß sich der Mensch gerne in seinen vorgefaßten Meinungen und Urteilen bestätigen läßt. Dies wirkt sich dem Fernsehen gegenüber so aus, daß der Zuschauer mit Vorliebe jene Programme auswählt und gut findet, die ihm von vornherein zusagen. Nichtzusagendes findet er schlecht oder falsch, er stellt ab und läßt es außer acht.
Der amerikanische Kommunikationsforscher J. T. Klapper schreibt dazu: »Die Kommunikationsforschung hat mehrfach bestätigt, daß Menschen durchwegs dazu neigen, nur solche Dinge zu lesen, anzuhören oder anzusehen, mit denen sie selbst sympathisieren, und daß sie Kommunikationen aus dem Wege gehen, die eine andere Färbung haben.«
.
Daraus geht zweierlei hervor:
Wir werden nicht nur gelegentlich manipuliert; wir manipulieren uns oft selber. Die Selbstmanipulation ist mindestens so gefährlich wie die Fremdmanipulation, denn sie macht uns zwangsläufig beschränkt und damit urteilsunfähig.
.
Fremdmanipulation und Eigenmanipulation
Die Auswirkungen der Fremdmanipulation sind offenbar gar nicht so erfolgreich und folgenschwer, denn die Zuschauer lehnen ohnehin ab, was ihren persönlichen Ansichten nicht entspricht. Manipulieren läßt sich gewissermaßen nur derjenige, der sich manipulieren lassen will, und auch dies nur in der Richtung seiner eigenen Vorurteile.
Dies könnten fast beruhigende Feststellungen sein, sind es aber nicht. Denn sie sind negativ und nehmen einen Zuschauer an, der stur in seinen übernommenen Denkschemata verharrt, der sich hinter einer Mauer von starren Ansichten verschanzt und sich im Gebüsch seiner Vorurteile versteckt, um nicht in unliebsame Auseinandersetzungen mit unbequemen Tatsachen und anderen Meinungen zu geraten.
Davor hat aber schon der alte Adolf Freiherr von Knigge gewarnt mit dem Wort: »Man glaubt gar nicht, welch eintöniges Wesen man wird, wenn man sich immer nur im Kreise seiner eigenen Lieblingsbegriffe bewegt und alles wegwirft, was nicht unsere Sache ist.«
.
Hier mein Blick auf die Schweiz
Gerade wir, in einer so umfassenden Demokratie wie der unsern, können uns aber einen solchen Zuschauer, und das heißt: einen solchen Menschen und Bürger, am allerwenigsten wünschen. Wir sind in Gemeinden, Kantonen, Bund und Ländern auf die breite und intensive Mitarbeit zeitaufgeschlossener, denkfähiger Bürger angewiesen.
Wir brauchen Bürger, die bereit sind, sich auch mit neuen, unbequemen Ideen auseinanderzusetzen. Vieles ist erhaltens- und pflegenswert in unserem Staat, vieles ist aber auch veränderungs- und verbesserungsbedürftig. Wenn wir uns selbstzufrieden, geistig satt und faul ins Schneckenhaus des Status quo zurückziehen, so bewirken wir damit nur jenen Stillstand, der Rückschritt bedeutet.
Nicht alles, das uns nicht in unseren persönlichen Kram paßt, ist immer auch Manipulation. Das Schlagwort »Manipulation« ist uns oft sehr willkommen als billige Ausflucht vor der Konfrontation, vor der Auseinandersetzung mit unliebsamen Tatsachen und Meinungen, mit unangenehmen Ereignissen und Problemen.
Darin manifestiert sich ein bedenklicher Hang zu ungestörter Ruhe. Ruhe ist aber gerade heute des Bürgers letzte Pflicht. Denn wenn er ruhig, uninteressiert, untätig, geistig unbeweglich bleibt, werden Staats- und demokratiefeindliche Kräfte ein um so leichteres Spiel mit ihm haben.
- Anmerkung : Eine Aussage aus der Schweiz von 1979 !!
.
Voraussetzungen für Manipulationen aller Art
An diesem Punkt wird unsere gesellschaftliche Situation sichtbar, die eine günstige Voraussetzung ist für Manipulationen aller Art: Der einzelne wird in unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft zunehmend überbeansprucht. Er muß sich ständig den verschiedensten Sachzwängen unterwerfen. Seine täglichen Probleme nehmen ihn derart gefangen, daß ihm kaum mehr Zeit und Kraft bleiben, sich als gesellschaftliches Wesen zu empfinden und zu betätigen.
Dies bewirkt die bekannte und verbreitete Vereinsamung des einzelnen. Sie wird noch verstärkt durch die hohe Mobilität des einzelnen, welche verhindert, daß sich einer noch mit gesellschaftlichen Institutionen identifiziert und dadurch auch psychisch stabilisiert. Die Folge ist, daß sich die Institutionen in zunehmendem Maße verselbständigen. Sie entwickeln eine unheimliche Eigengesetzlichkeit.
Es entsteht jener selbständige Machtapparat, innerhalb dessen der einzelne nur noch ein bloßer »Funktionsträger« ist. Wenn aber die eigenwillige Persönlichkeit, das geistig selbständige Individuum zum reinen Funktionsträger degeneriert, verfällt es wehrlos jeder Manipulation, jeder Steuerung und Lenkung durch politische, wirtschaftliche und ideologische Machtapparaturen.
.
Fernsehen: Droge, Hausaltar und Varieteersatz
.
Unsere Zeit der Überinformation (1979)
Kommt noch dazu, daß wir in einer Zeit der Überinformation leben. Ungeheuer, unübersehbar und geistig unverdaubar ist das tägliche Angebot an Informationen durch die Massenmedien Presse, Radio und Fernsehen, durch Bücher, Filme, Video-Kassetten und Schallplatten.
Wir sind einer visuellen und akustischen Reizüberflutung ausgesetzt, die wir nicht mehr zu bewältigen vermögen. Wir kämpfen vielleicht zunächst dagegen an, geben aber bald einmal den Widerstand auf, ergeben uns resigniert und treten die Flucht in die Betäubung an.
Dies muß nicht gleich mit der Droge LSD geschehen, es kann auch mit Alkohol sein, und wir können aber auch die Droge Fernsehen dazu mißbrauchen. Wir flüchten uns vor den Fernsehapparat. Er soll uns die Problematik unseres Daseins vergessen helfen. Er soll uns ablenken, er soll uns zerstreuen. Was man früher im Variete, im Tingeltangel suchte - möglichst problemlose Unterhaltung -, das erwartet man heute vom Fernsehen.
Und damit betreten wir einen anderen Teufelskreis der Manipulation, der, genau besehen, viel schlimmer ist als alles, was wir bisher an Manipulationsgefahren aufgezeigt haben. Man spricht immer nur von Manipulation in einzelnen Sendungen. Daß aber das gesamte Programm und unser falscher Umgang mit dem Medium Fernsehen manipulative Auswirkungen haben, bemerkt man kaum.
.
Was sieht das Publikum am liebsten ?
Das Fernsehen befragt das Publikum, welche Art von Sendungen es am liebsten sehen möchte. Das Ergebnis ist kaum erstaunlich: Eine überwiegende Mehrheit liebt und wünscht harmlose Lustigkeit, prickelnde Spannung, das leicht Unterhaltende, das Anspruchslose, das Seichte und Unproblematische.
Und das Fernsehen, das als Massenmedium immer um möglichst große Mehrheiten buhlt, bietet das Gewünschte in überreichem Maße und zu den günstigsten Sendezeiten. Es droht die Gefahr, daß Sendungen, die der geistigen Bereicherung, der Auseinandersetzung, der Konfrontation dienen, in bedenkliche Minderheit geraten und in die ungünstigsten Sendezeiten verdrängt werden, in denen sie die Ruhe der Zuschauermehrheit nicht mehr zu stören vermögen.
Wenn es so weit ist, hat der Zuschauer zwar das Fernsehen, das er sich wünscht, aber er hat gleichzeitig dazu beigetragen, daß das Medium mehr zu einem Instrument der geistigen Verödung und Lähmung (Anmerkung : der Verblödung) als der geistigen Weckung, Bereicherung und Aktivierung geworden ist.
Ein Fernsehen, dessen oberstes Anliegen es aber geworden ist, vor allem ein oberflächliches Unterhaltungsbedürfnis zu befriedigen, übt eine Manipulation aus, die auf die Dauer verheerend sein muß für ein Volk, das täglich zur Selbstgestaltung und Neugestaltung seiner Demokratie aufgerufen ist und dazu fähig bleiben sollte.
Was wir dringend brauchen, ist ein Publikum, das den Fernsehapparat nicht mit einem Hausaltar verwechselt, vor dem sich allabendlich die ganze Familie andächtig versammelt und alles, was diesem Apparat entströmt, gläubig als höhere Botschaft konsumiert.
Wir brauchen aber auch ein Publikum, das im Fernsehen nicht nur einen Varieteersatz erblickt und vom Medium nur noch harmlose Unterhaltung und Zerstreuung verlangt, sondern von ihm erwartet, daß es ihm auch etwas zur geistigen Belebung und Auseinandersetzung bietet. Wir brauchen ein waches und mündiges Publikum, das mit diesem verführerischen Instrument vernünftig umzugehen weiß, das den Apparat maßvoll und wohlüberlegt handhabt - und sich nicht ahnungslos von ihm handhaben läßt.
Einen Zuschauer, der einerseits die ihm passenden Sendungen sorgfältig auswählt und nicht seine Zeit wahllos vor dem Apparat vertrödelt, der aber anderseits auch nicht gleich abschaltet, wenn ihm einmal eine Sendung nicht gleich zusagt, weil sie von ihm Bereitschaft zum aufmerksamen Mitdenken fordert.
Einen Zuschauer, der nicht gleich hysterisch und neurotisch reagiert, wenn ihm einmal eine Sendung, ein Film, eine Diskussion, ein Kommentar wider den liebgewordenen Strich läuft.
Das Fernsehen braucht unbedingt denkende, denkfreudige, mitdenkende Zuschauer. Denn der Zuschauer wird im Fernsehen - und zwar nicht nur in politischen Informationssendungen, auch in kulturellen und wissenschaftlichen Sendungen, auch in Fernsehspielen und Unterhaltungssendungen - immer wieder mit Themen und Problemen, mit Informationen und Meinungen konfrontiert, die ihm neu sind.
.
Das Leben besteht aus Konflikten.
Es gibt keine Entwicklung und keinen Fortschritt ohne Konflikte. Als Informationsmedium wird das Fernsehen immer wieder Konflikte in alle Stuben tragen.
Und dann braucht es Zuschauer, die darüber nicht immer gleich Zeter und Mordio schreien und die Konflikte dem Fernsehen anlasten. Es liegt im Wesen eines recht verstandenen und richtig gehandhabten Fernsehens, daß es die Konflikte, Kollisionen und Konfrontationen in der Gesellschaft aufzeigt.
Und der Zuschauer muß lernen und bereit sein, diese Konflikte und Kollisionen nicht zu verdrängen und zu meiden, er muß sie bejahen und austragen lernen. Er muß bereit sein, sich durch das Fernsehen gelegentlich etwas zumuten zu lassen.
Alles ist Manipulation. Es hängt nicht vom Fernsehen und seinen Mitarbeitern allein, es hängt letzten Endes von jedem einzelnen von uns ab, ob und wie wir damit fertig werden. Es gibt im Grunde gegen das Manipuliertwerden nur ein sicheres Mittel:
.